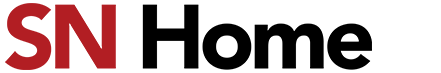
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
Leicht verständlichen Überblick zur Idee und Wirkweise der Kreislaufwirtschaft
von Martin Auerbach
Nachhaltigkeit kann auf
vielfältige Weise gesteigert werden
Schauen wir uns zunächst an, was Produkte nachhaltiger machen kann. Hierzu greife ich zurück auf das klassische Nachhaltigkeitsmodell1 mit den drei Säulen Ökologie (Auswirkungen auf die Umwelt), Ökonomie (Wirtschaftlichkeit, die es u.a. den Angestellten ermöglicht, von ihrer Arbeit zu leben) und Soziales (Einhaltung von anerkannten Sozialstandards) und fokussiere mich auf den ökologischen Aspekt. Die einfachste Form, ein Produkt (ökologisch) nachhaltiger zu machen ist es, dessen Lebenszeit zu verlängern. Hält es nämlich zum Beispiel dreimal so lang, wie ein vergleichbares Produkt, entfällt zweimal der Bedarf, mit neuen Ressourcen, entsprechendem Energieaufwand und CO2-Ausstoß ein neues Produkt herzustellen und zum Nutzer zu transportieren. Einen vergleichbaren Effekt hat es, wenn das Produkt gegenüber dem konventionellen Teil reparierbar oder sogar anpassungsfähig ist. Hierzu gibt es im Bereich elektronischer Geräte interessante Diskussionen. Laptops oder Handys sollen künftig so gestaltet werden, dass wichtige Bauteile austauschbar sind und an neue und höhere Anforderungen angepasst werden können. So bleibt das Gerät länger in Benutzung und dabei auch up-to-date. Wenn bei der Herstellung eines Produktes Recyclingmaterial einfließt, müssen für diesen Teil keine neuen Ressourcen angegriffen werden, was den sogenannten Material-Fußabdruck2 verbessert. Dem müssen jedoch der Energie- und CO2-Fußabdruck gegenübergestellt werden, die aus dem Recyclingprozess resultieren. Der Materialfußabdruck und folglich die Nachhaltigkeit kann auch dadurch verbessert werden, dass das ursprüngliche Ausgangsmaterial aus fossilen Quellen (zum Beispiel Erdöl) durch Ausgangsmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen (Rapsöl) ersetzt wird oder die erforderliche Prozessenergie regenerativen Ursprungs ist, statt aus fossilen Quellen. Beides kann natürlich kombiniert werden.
Ferner kann die Nachhaltigkeit eines Produkts erhöht werden, wenn das Material am Lebensende einer neuen Verwendung zugeführt wird, die auf einem qualitativ niedrigeren Niveau steht, als die Vornutzung. Aus dem Schaum von Matratzen kann zum Beispiel Isoliermaterial gefertigt werden. Diese Form der Weiterverwendung wird Downcycling genannt, technisch spricht man von Kaskaden3. Ferner können die Reduzierung des Strom- und Energieverbrauchs sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei der Produktion zu mehr Nachhaltigkeit führen. Auf der Materialseite kann z.B. durch ein neues Produktdesign Material eingespart werden, was den Materialfußabdruck verbessert und damit die Nachhaltigkeit erhöht. Eine solche Maßnahme führt zu mehr Ressourcen-Effizienz. Dabei ist der sogenannte Rebound-Effekt4 zu beachten.
Wirtschaftswachstum
muss ohne Steigerung des
Ressourcenverbrauchs möglich sein
Nachdem wir uns viele Beispiele dazu angeschaut haben, was Produkte nachhaltiger macht, kommen wir nun zu einem entscheidenden Teilaspekt von Nachhaltigkeit, nämlich der Kreislaufwirtschaft. Sie kann einen entscheidenden Beitrag bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und des Ressourcenverbrauchs leisten. Zudem ist die Kreislaufwirtschaft Voraussetzung für die u.a. von der EU geforderte Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, die beabsichtigt, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, ohne dass immer mehr Ressourcen benötigt werden. Aktuell haben wir eine sogenannte lineare Abfallwirtschaft, bei der Produkte ganz überwiegend auf den Gebrauchsvorteil ausgerichtet sind. Sie werden produziert, vertrieben, genutzt, dann entsorgt und in aller Regel verbrannt. Die Idee der Kreislaufwirtschaft ist es demgegenüber, ein Produkt von Anfang an so zu gestalten, dass es am Lebensende wieder auseinandergenommen werden kann und die Materialien so recycelt werden, dass sie wieder in die Produktion zurückfließen können.
Dazu müssen neben dem sogenannten Ökodesign auch entsprechend geeignete Materialien ausgesucht und verwendet werden. Damit am Produktlebensende die Beteiligten wissen, wie sie mit dem Produkt verfahren müssen, bedarf es einer individuellen Kennzeichnung des Produktes über die Informationen u.a. zu den verwendeten Materialien und geeigneten Recyclingmethoden aus einer Datenbank ausgelesen werden können. So wird sichergestellt, dass auch nach Jahren der Benutzung die für ein Recycling erforderlichen Informationen bereitstehen. Gleichzeitig stellt das Datenbanksystem sicher, dass technische Entwicklungen berücksichtigt werden.
Deutschland Recycling-Weltmeister?
Von der hier beschriebenen Kreislaufwirtschaft sind wir aktuell noch weit entfernt. Zwar berichtet das Umweltbundesamt von einer Recyclingquote in 2018 von 67 Prozent bei Verpackungsabfällen, jedoch resultiert dieser Anteil aus der sogenannten Input-Betrachtung, also was kommt bei den Entsorgern/Recyclern an. Im Gegensatz dazu schaut die Output-Betrachtung auf das, was nach dem Recyclingprozess an Recyclingmaterial herauskommt. Und da sind die Zahlen deutlich ernüchternder, beim Verpackungsmüll sind es nicht einmal 20 Prozent, wobei der größte Anteil von über 15 Prozent aus dem Recycling von PET-Flaschen stammt. Die reale Recycling-Quote für Verpackungsabfall bewegt sich also gerade einmal im einstelligen Prozentbereich. Wenn wir nun berücksichtigen, dass Verpackungsmüll einen Anteil von gut 40 Prozent am gesamten Aufkommen unserer Siedlungsabfälle5 ausmacht, wirkt sich dies erheblich auf unsere Gesamtrecyclingquote aus. Besonderes Schmankerl in diesem Zusammenhang: Die EU hat im Rahmen ihres 2. Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft für alle europäischen Mitgliedsstaaten eine Recyclingquote für Siedlungsabfälle von 55 Prozent in 2025 - also in knapp drei Jahren -, und zwar in der Output-Betrachtung, festgelegt. Sie dürfen selbst mutmaßen, wie wahrscheinlich es erscheint, dass irgendein EU-Staat diese Latte überspringt.
Unabhängig von den europäischen Vorgaben sollten wir aber auch mit Blick auf die umweltrelevanten Folgen unseres CO2-Ausstoßes und unseres Ressourcenverbrauchs schauen, wie wir den größten Hebel ansetzen können. Dieser Herausforderung müssen sich nicht nur die Unternehmen des produzierenden Gewerbes stellen. Vielmehr handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Stufen der Wertschöpfungskette und jeden Menschen einschließt.
Fußnoten:
1.
Gesellschaftliches Leitbild, bei dem jede Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne nachkommende Generationen zu gefährden. Dies wurde u.a. in den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen formuliert. Dabei sind soziale Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Schutz natürlicher Ressourcen untrennbar miteinander verbunden. (Echte) Kreislaufwirtschaft ist also stets ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Andersherum sind nicht alle Maßnahmen zur Nachhaltigkeit auch identisch mit Schritten hin zu echter Kreislaufwirtschaft (z.B. bei den SDG menschenwürdige Arbeit, wirtschaftliches Wachstum, Bekämpfung von Armut).
2.
Bezogen auf die Ökobilanzist der Fußabdruck als Zusammenfassung bzw. Darstellung der ermittelten negativen Umweltauswirkungen von Produkten zu verstehen. Basierend auf den in einer Ökobilanz verwendeten Umweltindikatoren spricht man z.B. auch vom Material-Fußabdruck, CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint) etc. Mit dem Begriff des Fußabdrucks können nicht nur die negativen ökologischen Auswirkungen von Produkten, sondern auch von Individuen, Organisationen oder Ländern verdeutlicht werden.
3.
Downcycling ist die Umwandlung von Abfällen in Sekundärrohstoffe von geringerem Wert. Bei der Herstellung neuer Produkte können oft nur bestimmte Anteile solcher Rezyklate beigemischt werden, ohne die Produktqualität zu reduzieren. Technisch sprechen Umweltingenieure von sogenannten Kaskaden.
4.
Einsparungen von Ressourcen oder Energie je funktioneller Einheit durch Steigerung der Effizienz oder Nutzung alternativer Materialien/Technologien werden durch Wirtschaftswachstum und erhöhten Konsum überkompensiert, so dass insgesamt mehr Ressourcen oder Energie eingesetzt werden. Prominentes Beispiel: Die Einführung von LED-Leuchtmitteln, die ab 2012 in Deutschland die Beleuchtung unseres Alltags übernommen haben, war als Beitrag zur Einsparung geplant. Tatsächlich war aber zu beobachten, dass das "sparsame" Licht einfach länger eingeschaltet bleibt und damit die Einsparungen sogar überkompensiert wird.
5.
Als Siedlungsabfall bezeichnet man Abfälle aus privaten Haushalten sowie hausmüllähnliche Abfälle aus Einrichtungen wie Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, aber auch aus Gewerbe und Industrie. Weiterhin zählen auch Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioabfälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie Glas und Papier zum Siedlungsabfall. Von den rund 50,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfällen im Jahr 2018 waren ca. 88 Prozent haushaltstypische Siedlungsabfälle und wiederum 30 Prozent davon Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, die gemeinsam über die öffentliche Müllabfuhr eingesammelt wurden. Eine Studie des Umweltbundesamts zur Zusammensetzung des Restmülls privater Haushalte aus dem Jahr 2020 zeigte, dass das Restmüllaufkommen aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr von 239 kg im Jahr 1983 auf 128 kg im Jahr 2018 gesunken ist. Diese Analyse zeigte aber auch, dass immer noch ein hoher Anteil an Wertstoffen im Restmüll enthalten ist, die so einer stofflichen oder energetischen Nutzung entzogen werden. Dazu gehören u.a. auch hohe Anteile von Kunststoffen, Altpapier, Glas und Verbundstoffen, die eigentlich getrennt werden sollen. Das Gesamtaufkommen von Verpackungsabfällen im Jahr 2018 betrug 18,9 Millionen Tonnen, das sind knapp 38 Prozent der Siedlungsabfälle. Die Zuständigkeit für den Hausmüll liegt in der Regel bei den Kommunen (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, örE), die wiederum private Entsorger beauftragen dürfen. Private und örE haben für die umweltfreundliche Entsorgung bzw. möglichst für das Recycling der Abfälle zu sorgen. Im Jahr 2018 wurden nach Angaben des Bundesumweltministeriums rund 67 Prozent der Siedlungsabfälle recycelt (Input-Betrachtung!).
Der Autor: Martin Auerbach
Martin Auerbach ist Geschäftsführer der drei Verbände im Kompetenz-Zentrum Textil+Sonnenschutz. Die Verbände der Deutschen Heimtextilien-Industrie (Heimtex), der Industrie für innenliegenden Sicht- und Sonnenschutzes (ViS) sowie der Matratzen-Industrie (Matratzen-Verband) arbeiten seit 2019 in der gemeinsamen Geschäftsstelle zusammen. Insbesondere bei branchenübergreifenden Themen, wie dem Datenschutz, der Rohstoffkrise oder der Kreislaufwirtschaft entfaltet das Netzwerk der Industrieverbände seine besondere Stärke. Im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft hat das Netzwerk eine besondere Expertise und versteht sich für seine Mitglieder als Wegbereiter und Frontrunner mit Kontakten zu wichtigen Stakeholdern entlang der Wertschöpfungsketten, der Abfall- und Recyclingindustrie sowie zu Behörden und Ministerien. Dieser Beitrag gibt einen leicht verständlichen Überblick zu Idee und Wirkweise der Kreislaufwirtschaft und grenzt sie zu anderen Nachhaltigkeitswerkzeugen ab. aus Carpet! 02/22 (Nachhaltigkeit)
Was hat Kreislaufwirtschaft mit dem Pudel zu tun?
Kenn Sie das? Ein Thema wird in den Medien hoch und runter diskutiert, Experten hauen sich Argumente um die Ohren, aber niemand ist in der Lage, das Thema, um das es geht, kurz und verständlich zu erklären. So scheint es auch bei dem Thema Kreislaufwirtschaft zu sein. Aus vielen Gesprächen wird erkennbar, dass einem Großteil der Akteure der Branche nach wie vor die richtige Einordnung der Kreislaufwirtschaft in den allgemeinen Kontext der Nachhaltigkeit schwerfällt bzw. Unsicherheit herrscht, was Kreislaufwirtschaft überhaupt ist. Hier kommt der Pudel in Spiel, denn bekanntlich ist jeder Pudel ein Hund, aber nicht jeder Hund ein Pudel. Ebenso verhält es sich mit der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit: Kreislaufwirtschaft trägt zur Nachhaltigkeit bei, Nachhaltigkeit kann aber auch auf verschiedenen anderen Ebenen erreicht werden.von Martin Auerbach
Nachhaltigkeit kann auf
vielfältige Weise gesteigert werden
Schauen wir uns zunächst an, was Produkte nachhaltiger machen kann. Hierzu greife ich zurück auf das klassische Nachhaltigkeitsmodell1 mit den drei Säulen Ökologie (Auswirkungen auf die Umwelt), Ökonomie (Wirtschaftlichkeit, die es u.a. den Angestellten ermöglicht, von ihrer Arbeit zu leben) und Soziales (Einhaltung von anerkannten Sozialstandards) und fokussiere mich auf den ökologischen Aspekt. Die einfachste Form, ein Produkt (ökologisch) nachhaltiger zu machen ist es, dessen Lebenszeit zu verlängern. Hält es nämlich zum Beispiel dreimal so lang, wie ein vergleichbares Produkt, entfällt zweimal der Bedarf, mit neuen Ressourcen, entsprechendem Energieaufwand und CO2-Ausstoß ein neues Produkt herzustellen und zum Nutzer zu transportieren. Einen vergleichbaren Effekt hat es, wenn das Produkt gegenüber dem konventionellen Teil reparierbar oder sogar anpassungsfähig ist. Hierzu gibt es im Bereich elektronischer Geräte interessante Diskussionen. Laptops oder Handys sollen künftig so gestaltet werden, dass wichtige Bauteile austauschbar sind und an neue und höhere Anforderungen angepasst werden können. So bleibt das Gerät länger in Benutzung und dabei auch up-to-date. Wenn bei der Herstellung eines Produktes Recyclingmaterial einfließt, müssen für diesen Teil keine neuen Ressourcen angegriffen werden, was den sogenannten Material-Fußabdruck2 verbessert. Dem müssen jedoch der Energie- und CO2-Fußabdruck gegenübergestellt werden, die aus dem Recyclingprozess resultieren. Der Materialfußabdruck und folglich die Nachhaltigkeit kann auch dadurch verbessert werden, dass das ursprüngliche Ausgangsmaterial aus fossilen Quellen (zum Beispiel Erdöl) durch Ausgangsmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen (Rapsöl) ersetzt wird oder die erforderliche Prozessenergie regenerativen Ursprungs ist, statt aus fossilen Quellen. Beides kann natürlich kombiniert werden.
Ferner kann die Nachhaltigkeit eines Produkts erhöht werden, wenn das Material am Lebensende einer neuen Verwendung zugeführt wird, die auf einem qualitativ niedrigeren Niveau steht, als die Vornutzung. Aus dem Schaum von Matratzen kann zum Beispiel Isoliermaterial gefertigt werden. Diese Form der Weiterverwendung wird Downcycling genannt, technisch spricht man von Kaskaden3. Ferner können die Reduzierung des Strom- und Energieverbrauchs sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei der Produktion zu mehr Nachhaltigkeit führen. Auf der Materialseite kann z.B. durch ein neues Produktdesign Material eingespart werden, was den Materialfußabdruck verbessert und damit die Nachhaltigkeit erhöht. Eine solche Maßnahme führt zu mehr Ressourcen-Effizienz. Dabei ist der sogenannte Rebound-Effekt4 zu beachten.
Wirtschaftswachstum
muss ohne Steigerung des
Ressourcenverbrauchs möglich sein
Nachdem wir uns viele Beispiele dazu angeschaut haben, was Produkte nachhaltiger macht, kommen wir nun zu einem entscheidenden Teilaspekt von Nachhaltigkeit, nämlich der Kreislaufwirtschaft. Sie kann einen entscheidenden Beitrag bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und des Ressourcenverbrauchs leisten. Zudem ist die Kreislaufwirtschaft Voraussetzung für die u.a. von der EU geforderte Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, die beabsichtigt, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, ohne dass immer mehr Ressourcen benötigt werden. Aktuell haben wir eine sogenannte lineare Abfallwirtschaft, bei der Produkte ganz überwiegend auf den Gebrauchsvorteil ausgerichtet sind. Sie werden produziert, vertrieben, genutzt, dann entsorgt und in aller Regel verbrannt. Die Idee der Kreislaufwirtschaft ist es demgegenüber, ein Produkt von Anfang an so zu gestalten, dass es am Lebensende wieder auseinandergenommen werden kann und die Materialien so recycelt werden, dass sie wieder in die Produktion zurückfließen können.
Dazu müssen neben dem sogenannten Ökodesign auch entsprechend geeignete Materialien ausgesucht und verwendet werden. Damit am Produktlebensende die Beteiligten wissen, wie sie mit dem Produkt verfahren müssen, bedarf es einer individuellen Kennzeichnung des Produktes über die Informationen u.a. zu den verwendeten Materialien und geeigneten Recyclingmethoden aus einer Datenbank ausgelesen werden können. So wird sichergestellt, dass auch nach Jahren der Benutzung die für ein Recycling erforderlichen Informationen bereitstehen. Gleichzeitig stellt das Datenbanksystem sicher, dass technische Entwicklungen berücksichtigt werden.
Deutschland Recycling-Weltmeister?
Von der hier beschriebenen Kreislaufwirtschaft sind wir aktuell noch weit entfernt. Zwar berichtet das Umweltbundesamt von einer Recyclingquote in 2018 von 67 Prozent bei Verpackungsabfällen, jedoch resultiert dieser Anteil aus der sogenannten Input-Betrachtung, also was kommt bei den Entsorgern/Recyclern an. Im Gegensatz dazu schaut die Output-Betrachtung auf das, was nach dem Recyclingprozess an Recyclingmaterial herauskommt. Und da sind die Zahlen deutlich ernüchternder, beim Verpackungsmüll sind es nicht einmal 20 Prozent, wobei der größte Anteil von über 15 Prozent aus dem Recycling von PET-Flaschen stammt. Die reale Recycling-Quote für Verpackungsabfall bewegt sich also gerade einmal im einstelligen Prozentbereich. Wenn wir nun berücksichtigen, dass Verpackungsmüll einen Anteil von gut 40 Prozent am gesamten Aufkommen unserer Siedlungsabfälle5 ausmacht, wirkt sich dies erheblich auf unsere Gesamtrecyclingquote aus. Besonderes Schmankerl in diesem Zusammenhang: Die EU hat im Rahmen ihres 2. Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft für alle europäischen Mitgliedsstaaten eine Recyclingquote für Siedlungsabfälle von 55 Prozent in 2025 - also in knapp drei Jahren -, und zwar in der Output-Betrachtung, festgelegt. Sie dürfen selbst mutmaßen, wie wahrscheinlich es erscheint, dass irgendein EU-Staat diese Latte überspringt.
Unabhängig von den europäischen Vorgaben sollten wir aber auch mit Blick auf die umweltrelevanten Folgen unseres CO2-Ausstoßes und unseres Ressourcenverbrauchs schauen, wie wir den größten Hebel ansetzen können. Dieser Herausforderung müssen sich nicht nur die Unternehmen des produzierenden Gewerbes stellen. Vielmehr handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Stufen der Wertschöpfungskette und jeden Menschen einschließt.
Fußnoten:
1.
Gesellschaftliches Leitbild, bei dem jede Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne nachkommende Generationen zu gefährden. Dies wurde u.a. in den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen formuliert. Dabei sind soziale Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Schutz natürlicher Ressourcen untrennbar miteinander verbunden. (Echte) Kreislaufwirtschaft ist also stets ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Andersherum sind nicht alle Maßnahmen zur Nachhaltigkeit auch identisch mit Schritten hin zu echter Kreislaufwirtschaft (z.B. bei den SDG menschenwürdige Arbeit, wirtschaftliches Wachstum, Bekämpfung von Armut).
2.
Bezogen auf die Ökobilanzist der Fußabdruck als Zusammenfassung bzw. Darstellung der ermittelten negativen Umweltauswirkungen von Produkten zu verstehen. Basierend auf den in einer Ökobilanz verwendeten Umweltindikatoren spricht man z.B. auch vom Material-Fußabdruck, CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint) etc. Mit dem Begriff des Fußabdrucks können nicht nur die negativen ökologischen Auswirkungen von Produkten, sondern auch von Individuen, Organisationen oder Ländern verdeutlicht werden.
3.
Downcycling ist die Umwandlung von Abfällen in Sekundärrohstoffe von geringerem Wert. Bei der Herstellung neuer Produkte können oft nur bestimmte Anteile solcher Rezyklate beigemischt werden, ohne die Produktqualität zu reduzieren. Technisch sprechen Umweltingenieure von sogenannten Kaskaden.
4.
Einsparungen von Ressourcen oder Energie je funktioneller Einheit durch Steigerung der Effizienz oder Nutzung alternativer Materialien/Technologien werden durch Wirtschaftswachstum und erhöhten Konsum überkompensiert, so dass insgesamt mehr Ressourcen oder Energie eingesetzt werden. Prominentes Beispiel: Die Einführung von LED-Leuchtmitteln, die ab 2012 in Deutschland die Beleuchtung unseres Alltags übernommen haben, war als Beitrag zur Einsparung geplant. Tatsächlich war aber zu beobachten, dass das "sparsame" Licht einfach länger eingeschaltet bleibt und damit die Einsparungen sogar überkompensiert wird.
5.
Als Siedlungsabfall bezeichnet man Abfälle aus privaten Haushalten sowie hausmüllähnliche Abfälle aus Einrichtungen wie Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, aber auch aus Gewerbe und Industrie. Weiterhin zählen auch Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioabfälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie Glas und Papier zum Siedlungsabfall. Von den rund 50,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfällen im Jahr 2018 waren ca. 88 Prozent haushaltstypische Siedlungsabfälle und wiederum 30 Prozent davon Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, die gemeinsam über die öffentliche Müllabfuhr eingesammelt wurden. Eine Studie des Umweltbundesamts zur Zusammensetzung des Restmülls privater Haushalte aus dem Jahr 2020 zeigte, dass das Restmüllaufkommen aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr von 239 kg im Jahr 1983 auf 128 kg im Jahr 2018 gesunken ist. Diese Analyse zeigte aber auch, dass immer noch ein hoher Anteil an Wertstoffen im Restmüll enthalten ist, die so einer stofflichen oder energetischen Nutzung entzogen werden. Dazu gehören u.a. auch hohe Anteile von Kunststoffen, Altpapier, Glas und Verbundstoffen, die eigentlich getrennt werden sollen. Das Gesamtaufkommen von Verpackungsabfällen im Jahr 2018 betrug 18,9 Millionen Tonnen, das sind knapp 38 Prozent der Siedlungsabfälle. Die Zuständigkeit für den Hausmüll liegt in der Regel bei den Kommunen (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, örE), die wiederum private Entsorger beauftragen dürfen. Private und örE haben für die umweltfreundliche Entsorgung bzw. möglichst für das Recycling der Abfälle zu sorgen. Im Jahr 2018 wurden nach Angaben des Bundesumweltministeriums rund 67 Prozent der Siedlungsabfälle recycelt (Input-Betrachtung!).
Der Autor: Martin Auerbach
Martin Auerbach ist Geschäftsführer der drei Verbände im Kompetenz-Zentrum Textil+Sonnenschutz. Die Verbände der Deutschen Heimtextilien-Industrie (Heimtex), der Industrie für innenliegenden Sicht- und Sonnenschutzes (ViS) sowie der Matratzen-Industrie (Matratzen-Verband) arbeiten seit 2019 in der gemeinsamen Geschäftsstelle zusammen. Insbesondere bei branchenübergreifenden Themen, wie dem Datenschutz, der Rohstoffkrise oder der Kreislaufwirtschaft entfaltet das Netzwerk der Industrieverbände seine besondere Stärke. Im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft hat das Netzwerk eine besondere Expertise und versteht sich für seine Mitglieder als Wegbereiter und Frontrunner mit Kontakten zu wichtigen Stakeholdern entlang der Wertschöpfungsketten, der Abfall- und Recyclingindustrie sowie zu Behörden und Ministerien. Dieser Beitrag gibt einen leicht verständlichen Überblick zu Idee und Wirkweise der Kreislaufwirtschaft und grenzt sie zu anderen Nachhaltigkeitswerkzeugen ab. aus Carpet! 02/22 (Nachhaltigkeit)
