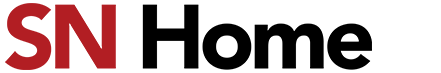
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
SN-Verlag Roundtable: Die Zukunft von PVC im Hinblick auf die EU-Chemikalienstrategie
Die Europäische Kommission hat im Herbst 2020 die Chemikalienstrategie für eine nachhaltigere und schadstofffreie Umwelt verabschiedet. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollen sie in den kommenden Jahren umsetzen. In diesem Zusammenhang werden chemische Stoffe und Stoffgruppen auf mögliche umwelt- und/oder gesundheitsgefährdende Eigenschaften unter die Lupe genommen. Nach 30 Jahren steht damit auch PVC wieder auf dem Prüfstand. Eine von der EU in Auftrag gegebene Studie befasst sich ausführlich mit dessen Produktion, Absatz, Recycling - und Risikofaktoren.
Was bedeutet das für unsere Branche? PVC spielt eine große Rolle bei Bodenbelägen und noch viel mehr bei Tapeten, wo der Werkstoff mit weitem Abstand dominiert. Der SN-Verlag Hamburg, in dem auch FussbodenTechnik erscheint, lud daher zu einer Expertenrunde ein, in der Vertreter der EU, der Industrie und des Verlegehandwerks die Studie, mögliche Auswirkungen und Lösungsansätze wie Materialalternativen, Produktdeklarationen, Recycling- und Kreislaufkonzepte erörterten. Denn all dies kann auf die Hersteller, Verarbeiter und Inverkehrbringer von chemischen Produkten zukommen.
Eingangs gab Branchenkenner Karl-Heinz Scholz (S & P Consultants), der im Bodenbelagsbereich nicht nur verschiedene Führungspositionen bekleidete, sondern auch Produktpatente hält, einen Überblick über die PVC-Diskussion in der Bauwirtschaft (Zusammenfassung siehe Kasten auf Seite 152). Prof. Dr. Helmut Maurer, von 2002 bis Juli 2022 in der EU-Kommission mit Abfall, Chemikalien, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit befasst, stellte die PVC-Studie der EU vor (Zusammenfassung siehe Kasten unten auf dieser Seite). Deren Hintergrund ist der "Green Deal", den die EU 2019 verabschiedet hat - mit dem Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.
PVC-Studie der EU
stößt auf Widerspruch
Die Abhandlung selbst stieß in der Runde auf große Kritik. Der Chemiker Dr. Thomas Hohberg vom Bodenbelagshersteller Windmöller beurteilte sie "aus wissenschaftlicher Sicht als schwach, fehlerhaft und schlecht recherchiert". An vielen Stellen fehlten "Hand und Fuß". Exemplarisch verwies Hohberg auf eine Liste der Inhaltsstoffe von PVC, die nicht mehr bzw. nie im Einsatz gewesen seien. Edwin Lingg, Gründer und Geschäftsführer des Bodenbelagsherstellers Lico, pflichtete dem bei: "Mindestens 70 % der aufgeführten Komponenten werden seit zehn Jahren nicht mehr für Bodenbeläge verwendet."
Ullrich Eitel, Geschäftsführender Gesellschafter der Marburger Tapetenfabrik, zweifelte die prognostizierte Verdoppelung des PVC-Verbrauchs bis 2050 an: "Das ist zu kurz gedacht. Weil wir eine Marktwirtschaft haben. Wir erleben ja gerade, das alles, was vor Wochen richtig war, nun nicht mehr stimmt. Vieles verändert sich durch den Ukraine-Krieg, viele Fragen stehen im Raum, die wichtiger zu beantworten sind als die Frage nach PVC.
PVC verfüge über viele gute Gebrauchseigenschaften, zum Boom von PVC-Produkten dürfte jedoch im wesentlichen auch der günstige Preis beigetragen haben, wurde bei der Diskussion betont - das sei bei Bodenbelägen nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber in der Tendenz ähnlich. Edwin Lingg, der eine Vielzahl an Produkten auf unterschiedlicher Materialbasis produziert, sagte: "Wir investieren 80 % unserer Entwicklungskosten in Naturböden, leben aber zu 90 % vom PVC. PVC ist im Preis-Leistungs-Verhältnis weit voraus, keiner unserer anderen Beläge kommt dort heran." Nach seiner Beobachtung sei PVC oft "emotional belastet": "Ich bin mir gar nicht so sicher, ob PVC wirklich so schlecht ist und andere Kunststoffe gut." Auch Thorsten Beinke von Tarkett warnte davor, "PVC pauschal in die schlechte Ecke zu stellen".
Aus Sicht von Dr. Thomas Hohberg habe PVC vor allem ein Additiv-Problem: "Wir haben gelernt, dass die Additive, vor allem die Weichmacher, im PVC Wirkungen haben, von denen man früher nichts gewusst hat. Aber daran wird seit Jahrzehnten vom Gesetzgeber und der Industrie gearbeitet und die kritischen und toxischen Stoffe sind nicht mehr im Einsatz." Für Volker Kettler, den Leiter des Produktmanagements und der Produktentwicklung der Meisterwerke, sei das Thema Weichmacher gar nicht mehr so brisant: "Die heutigen PVC-Beläge enthalten weniger Weichmacher als früher. Abgesehen davon sind ca. 50 % der Absatzmenge inzwischen ohnehin Rigid-Böden, die zu großen Teilen aus PVC und Füllstoffen bestehen. Weichmacher sind darin nur noch in geringem Umfang vorhanden."
PVC-Alternativen
für Bodenbeläge
Ist PVC also alternativlos? Bei Bodenbelägen sei das Spielfeld deutlich groß und es gebe bereits diverse PVC-freie Alternativen, wurde bei der Diskussion deutlich. Windmöller beispielsweise setzt auf Polyurethan (PU): "Das sind inzwischen unsere wichtigsten Produkte, mit denen wir über 50 % des Umsatzes erzielen", sagte Dr. Thomas Hohberg. "Unser PU basiert rohstoffseitig auf Rhizinusöl und ist durchaus im Commercial-Bereich im Einsatz, auch in anspruchsvollen Objekten wie Krankenhäusern. Wir sind davon überzeugt, dass dies die richtige Lösung ist."
Auf einen anderen Werkstoff, nämlich Polypropylen, das zur Polyolefin-Gruppe gehört, baut Classen. Das Unternehmen, ursprünglich Laminathersteller, ist vor sieben Jahren mit Polymermaterialien gestartet: "Wir haben damit zunächst eine Schlappe hingelegt. Erst mit der zweiten Generation sind wir durchgestartet", bekannte Sebastian Wendel, Leiter der Strategischen Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeitsbeauftragter, offen. Die komplette Belagskonstruktion einschließlich des integrierten Trittschalls werde aus der Polyolefin-Gruppe gefertigt - u. a. erleichtere dies das Recycling: "Wir können Sekundärrohstoffe aufnehmen, die im Markt vorhanden sind, zum Beispiel aus der Verpackungsindustrie."
Alle Anwesenden sind gegen
ein generelles PVC-Verbot
Gegen ein generelles Verbot von PVC sprachen sich alle Teilnehmer des Roundtable aus. Welche Möglichkeiten gebe es dann, mit der EU-Chemikalienstrategie konform zu gehen? Edwin Lingg plädierte für eine Regulierung via CO2-Abgabe als "ideales, faktenbelegtes Instrument". Über die Umweltsteuer, die die CO2-Emissionen bepreist, sollen Verbraucher und Unternehmen zum Umstieg auf klimafreundliche Lösungen bewegt werden. "Und wenn das Geld kostet, macht sich jeder ernsthaft Gedanken und sucht nach einer Lösung", war Lingg überzeugt. "Es muss weh tun - und es muss gleich verteilt sein. Dann betrifft es uns alle und dann wird sich auch etwas ändern."
Prof. Dr. Helmut Maurer stellte ein Produktregistrierungskonzept in den Raum, in dem alle ökologisch und gesundheitsrelevanten Faktoren benannt und quantifiziert werden. Die Idee ist nicht neu: Umwelt-Produktdeklaration (EPD) und Ökobilanzen gehen in diese Richtung. Dr. Thomas Hohberg sah die Bodenbelagsindustrie hier als Vorreiter: "Wir haben das praktisch für alle unsere Produkte vorliegen und jeder kann nachschauen, wie hoch der CO2-Fußabdruck oder der Energiebedarf sind." Nachteil: Vergleiche seien schwierig. Sebastian Wendel hielt EPDs auch nur bedingt für geeignet: "Der Architekt kann etwas damit anfangen, aber Endverbraucher nicht. Das ist nicht so leicht verständlich wie beim Kühlschrank mit A+ und A++."
Dafür brachte Wendel die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) ins Spiel. Prof. Maurer bewertete sie als "Ansatz, der halbwegs funktioniert, aber falsch ist", weil sie in Wahrheit keine Verantwortung des Herstellers für seine Produkte sei, sondern nur für den Abfall: "Eine Art Ablasshandel." Der richtige Weg wäre für Maurer, "an der Quelle zu beginnen und die Hersteller zu einer nachhaltigen Produktion zu verpflichten." Für Wendel erfülle Classen diese Anforderungen bereits: "Eigentlich haben wir alles richtig gemacht: Kein PVC, ein Produkt auf einer durchgängigen Stoff-Basis, zu 100 % recycelbar und 25 % Anteil Recyclingmaterial." Er wünschte sich von der EU entweder einen Anreiz und Unterstützung für die Industrie, die sich für nachhaltige, recycelbare Produkte engagiert oder andersherum eine Sanktionierung bzw. Abgabe für nicht Recycelfähiges.
PVC-Recycling ist mit
Herausforderungen verbunden
Nun sei es nicht so, dass PVC nicht recycelfähig sei - es lasse sich durch die thermoplastischen Eigenschaften sogar sehr gut recyceln, sagte Dr. Thomas Hohberg, was Thorsten Beinke vom großen PVC-Verarbeiter Tarkett unterstrich: "Monomere, sprich homogene PVC-Beläge, können wir im Prinzip sogar in den Farben recyceln." Auch Edwin Lingg steuerte Praxiswissen bei: "Wir recyceln unsere PVC-Böden zu 100 % ohne downzugraden. Wir machen genau dasselbe Produkt wieder daraus. Das funktioniert sogar relativ einfach." Wobei Recycling nicht gleich Recycling ist. Kann man bei Verschnittresten von der Baustelle von Recycling sprechen? Ja. Bei Post Consumer-Abfällen, sprich Altbelägen? Auf jeden Fall. Bei Randabschnitten aus der Produktion? Nach aktueller Definition nicht mehr.
Eine Herausforderung beim Recycling sind die Inhaltsstoffe des PVC: Laut Beinke können sie inzwischen auch bei verlegter Ware mittels Scantechnik identifiziert werden. Hohberg kannte allerdings noch keine "vernünftige Methode, um Weichmacher oder Blei-Additive zu separieren. Es gibt wissenschaftliche Ansätze, aber noch ist nichts spruchreif". Und nur eine Planke mit einem kritischen Weichmacher könne beim Recycling eine ganze Charge kontaminieren.
Eine weitere Herausforderung ergebe sich bei Multilayer-Böden durch die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe: "Für mich ist es eine Todsünde, eine PVC-Decklage mit einem Holzwerkstoffträger zusammenzubringen. Daraus kann man gar nichts mehr machen", sagte Volker Kettler von den Meisterwerken. Dem widersprach Lico-Geschäftsführer Edwin Lingg vehement: Das sei sogar relativ einfach zu trennen. Sebastian Wendel sprang Kettler bei und hielt besonders Konstruktionen mit integriertem Trittschall aus XPE, EVA oder Kork für problematisch: "Das passt dann nicht mehr so gut im Recycling." Hier hielt Lingg ebenfalls dagegen: "Auch das ist nicht schwierig. Es hängt vom Aufbau des Belags ab: Wenn man von vornherein weiß, dass die einzelnen Schichten wieder voneinander getrennt werden sollen, kann man das steuern, indem man sie zum Beispiel mit einem Kleber verbindet, der bei 70 °C wieder anlöst. Wir sind heute schon viel weiter, was die Trennung von Materialien betrifft. Ich bin überzeugt, dass es auch Technologien gibt, mit denen man den Bodenbelagskleber und den Zement trennen kann."
Wendel warb grundsätzlich für mehr Schulterschluss in der Industrie: "Wenn wir anfangen in einer Dimension zu denken, ,Design for Recycling’ und eventuell noch eine entsprechende Verpflichtung kommt, sind wir ein ganzes Stück weiter." Kettler brachte noch eine andere Perspektive ein: "So wie augenblicklich die Rohstoffpreise explodieren, ist das ein sehr viel wirksameres Mittel im Sinne der Ressourcenschonung und Nutzung von Sekundärrohstoffen. Das wirkt wie ein Katalysator. Jedes Gramm Abfall wird nicht mehr leichtfertig weggeworfen, sondern zurück in den Produktionsprozess geführt werden."
Kreislaufwirtschaft
aus Sicht der Industrie
Volker Kettler ging noch über das Recycling hinaus: "Die Materialität ist nicht das Maß der Dinge, sondern die Zirkularität." Er mahnte: "Bitte nicht Recycling mit Zirkularität verwechseln. Das sind zwei ganz verschiedene Themen. Zirkularität bedeutet Abfallvermeidung, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Recycling ist ein Mittel zum Zweck." Er könne sich vorstellen, dass Produktkreisläufe in der Branche funktionieren könnten - "wenn wir Produktcluster bilden und die Gruppen groß genug sind. Aber bei Exotenprodukten wird es schwierig".
Sebastian Wendel war skeptischer - vor allem, was die Logistik betrifft: "Ich persönlich glaube nicht daran, dass die Bodenbelagsindustrie es schafft, in dieser Mannigfaltigkeit die Produkte zurückzunehmen. Nicht in unserem globalen Markt. Wer will denn einen Bodenbelag aus den USA nach Deutschland zurückführen? Sie müssten vor Ort recyclingfähig sein, zum Beispiel über die lokalen Wertstoffhöfe."
Edwin Lingg konterte: "Wieso soll das nicht funktionieren? Wir bieten das mit unserem Second Life-Konzept an. Wir bezahlen jeden m2 Fußboden, den man uns zurückgibt und machen daraus einen komplett neuen. Und wenn das mehr Altböden werden, werden wir eine eigene Sparte aufbauen, die sich darum kümmert." Aber die EU müsse das steuern: "Wenn Produkte 20.000 km über den Ozean transportiert werden, mehr CO2 erzeugen und die Umwelt mehr belasten, muss das etwas kosten."
Die Meisterwerke haben ebenfalls ein Rücknahme- und Recyclingkonzept für Rigid-Designböden entwickelt: "Wir organisieren die gesamte Prozesskette, angefangen von der Bereitstellung der Sammelboxen bei Fachhändlern bis zum Rücktransport mit unseren eigenen Lkw", erläuterte Kettler. Dabei gebe es allerdings einige bürokratische Hürden zu überwinden: Unter anderem gelten Altbeläge als Abfall und seien daher in der Transportmenge auf 800 kg beschränkt. Voraussetzung für ein funktionierendes System sei zudem, dass die Kunden mitspielten und große Vertragshändler eingebunden werden könnten. Wendels Zweifel blieben: "Ich halte eine Organisation der Warenströme in Europa trotzdem für zu aufwendig und zu teuer - von Übersee gar nicht zu reden. Dann müssten auch die ganzen asiatischen Anbieter ihre Ware zurücknehmen, oder zumindest die europäischen Importeure."
Karl-Heinz Scholz mahnte davor, sich zu lange Zeit für Lösungsüberlegungen zu lassen. Die Wettbewerber im asiatischen Raum seien schnell und effizient und würden kurzfristig auf Marktveränderungen und -anforderungen reagieren. China-Kenner Oliver Kluge, der seit über 30 Jahren dortige Produktionen kennt und verfolgt, sagte: "Ich kann unterstreichen, dass es hier eine absolute Notwendigkeit gibt. In China wird derzeit intensiv diskutiert, was als Nächstes kommen wird und dabei sind PVC-freie Beläge ein großes Thema. Und ich glaube, bei der Geschwindigkeit, die die Chinesen in der Vergangenheit vorgelegt haben, brauchen wir nicht zu diskutieren, dass etwas in der Richtung kommen wird. Das heißt, wenn wir in Europa nicht alle zusammen - Industrie, Verarbeiter und auch Gesetzgeber - etwas etablieren, sieht die Zukunft düster aus." Scholz schloss sich dem Warnruf an: "Wir müssen jetzt beginnen, Konzepte zu entwickeln, die nicht so einfach zu kopieren sind. Die können nicht rein produkt- bzw. materialbezogen sein, aber zum Beispiel wären Rücknahmesysteme eine Option."
Kreislaufwirtschaft aus
Sicht des Verarbeiters
Was denkt die Verarbeiterseite darüber? Die Expertise aus der Praxis kam von Bernhard Lübbers. Der Objekteur mit Stammsitz in Hamburg und Niederlassung in Berlin stattet Büros, Hotels, Wohnanlagen und Schiffe in ganz Deutschland schlüsselfertig aus. Mit der Entsorgung von Altbelägen habe sein Betrieb in der Regel wenig zu tun, bei größeren Projekten werde dies vom Auftraggeber meist an Abbruchunternehmen ausgeschrieben, "die lediglich prüfen, ob Asbest oder PAK-Anhaftungen vorhanden sind und die Altbeläge dann als Müll in die Verbrennung geben." Lübbers selbst überlässt die Deinstallation auch einem professionellen Entsorger. Die Entsorgung sei mit Kosten von ca. 60 Cent/m2 aktuell die günstigere und einfachere Lösung gegenüber einer Rückgabe: "Das ist viel zu billig - und es ist viel zu aufwendig, ein Produkt dem Recycling oder einer Zweitverwertung zuzuführen."
Für Letzteres gab Lübbers ein Beispiel: So verspreche etwa ein Bodenbelagshersteller die Rücknahme seiner Paletten - sofern sie trocken gelagert, zu maximal acht übereinander gestapelt, mit Verzurrgurten versehen und in Folie verpackt seien. Außerdem müsse die Abholung 14 Tage im Voraus bestellt werden. Lübbers meinte: "Schon nach dem vierten Punkt ist das zu kompliziert, geschweige denn wirtschaftlich darstellbar." Und: "Aber wir Kunden bezahlen mit jedem Kilo Spachtelmasse und Kleber die theoretische Entsorgung." Lübbers nüchternes Fazit lautete: "Es gibt kein Rücknahmesystem, das funktioniert."
Doch übte der Objekteur nicht nur Kritik, sondern steuerte auch konstruktive Vorschläge bei: "Ich glaube, das Thema muss für Bodenbeläge ganz anders aufgefasst werden. Entsorgung muss teurer und die Rückgabe attraktiv und leichter gemacht werden." Die Voraussetzungen dafür seien vorhanden. "Wir haben die Produkte und die Infrastruktur durch ein dichtgestreutes Händlernetz. Organisieren lässt sich alles über eine App. Digitale Systeme erleichtern die entsprechende Kommunikation und Dokumentation." Zugleich sah Lübbers darin wie Karl-Heinz Scholz eine Chance für die europäische Industrie, mit einem "intelligenten System und intelligenten Marketing ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, das asiatische Anbieter nicht kopieren können. Unsere Dienstleistung wird wertvoller, und wir können die Wertschöpfungskette gegenüber ausländischen Anbietern von Billigprodukten sauber halten, weil es ein Konzept ist."
Prof. Dr. Helmut Maurer zur PVC-Studie der EU
"PVC-Alternativen sind reichlich vorhanden"
Die EU hat eine umfassende Studie über PVC aufgelegt, die den Werkstoff kritisch beleuchtet. Die Ergebnisse fasste Prof. Dr. Helmut Maurer beim Roundtable des SN-Verlags folgendermaßen zusammen:
- PVC als Material: PVC ist ein kostengünstiges Polymer mit vielen Additiven - insgesamt ca. 370, davon hauptsächlich Stabilisatoren und Weichmacher. Die meisten können dazu neigen, zu migrieren: zum Beispiel in die Haut, Atemluft und Grundwasser. Grundsätzlich herrschten Datenlücken zu Migration und Bioverfügbarkeit von Additiven.
-PVC-Produktion: Weltweit würden ca. 60 Mio. t PVC produziert, davon rund 50 % in China (steigend) und 10 % in der EU (fallend) mit Deutschland und Frankreich als größten Produzenten. Wichtigster Markt sei ebenfalls China. Die Nachfrage nach PVC nehme auch aus anderen Ländern zu, daher prognostiziert die Studie eine Verdoppelung des Verbrauchs bis 2050 - mit entsprechenden Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß.
-PVC-Entsorgung: Nach Zahlen des Netzwerks Vinylplus fielen 2020 ca. 2,9 Mio. t Post-Consumer-PVC-Abfälle an. Gut die Hälfte davon wurde zur Energiegewinnung verbrannt, jeweils ca. 25 % deponiert und recycelt (730.000 t). Risiken sieht die EU-Studie bei der energetischen Verwendung von PVC-Abfällen, durch die Verbrennung im Freien sowie in der illegalen Entsorgung und illegalen Verbringung unter falscher Deklaration. Die Daten zu PVC-Abfallmengen und -entsorgung seien unzureichend.
-PVC-Recycling: Ca. 730.000 t würden jährlich recycelt, überwiegend Hart-PVC. Alte Additive stellten ein Problem dar, Dekontaminierungsverfahren fehlten. Zudem sei Recycling ein Herstellungsprozess und als solcher energieintensiv und mit Emissionen verbunden. Und: In der Regel finde ein Downcycling statt. Nur 7 bis 9 % Alt-PVC würden adäquat zu Virgin-PVC in den Kreislauf zurückgeführt.
-PVC-Alternativen: Diese seien reichlich vorhanden - vor allem andere Kunststoffe, Metall und Holz. Ihre Verwendung würde Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen verringern.
-PVC-Ausstiegsszenarien: Diese seien noch offen. Die Daten zu einer Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen seien unzureichend. In der Automobilindustrie und im Bauwesen habe allerdings bereits der Ausstieg aus der Verwendung von PVC begonnen.
Karl-Heinz Scholz über die PVC-Diskussion in der Bauindustrie
"Keine Lösung für die sach- und umweltgerechte Entsorgung von PVC-Belägen"
Polyvinylchlorid (PVC) wurde in den 1910er-Jahren entwickelt und erlebte bis Anfang der 1990er-Jahre einen unaufhaltsamen Aufstieg. Dann geriet der Massenkunststoff wegen umwelt- und gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe (Chlor, Schwermetalle und Weichmacher) in die Kritik und wurde in einigen Kommunen verboten. Im Jahr 2000 stand er vor einem generellen Verbot, was von der einschlägigen PVC-Industrie nur durch eine freiwillige Selbstverpflichtung verhindert werden konnte. Sie gründete das Vinylplus-Programm, mit dem ein langfristiger Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte PVC-Wertschöpfungskette geschaffen werden sollte. 2001, 2010 und 2021 wurden jeweils Zehn-Jahres-Ziele für die Herstellung von PVC, Additiven, Entsorgung bzw. Recycling sowie Forschung und Entwicklung festgelegt.
Bis 2020 sollten unter anderem die jährliche PVC-Recyclingmenge auf 800.000 t steigen (2025: 900.000 t, 2030: 1 Mio. t), der nachhaltige Einsatz von Additiven gefördert, die Nachhaltigkeit von PVC-Produkten verbessert, CO2-Emissionen, Energie- und Ressourcenverbrauch schrittweise reduziert werden. Tatsächlich wurden 2020 über 730.000 t PVC recycelt, aber das waren hauptsächlich Fenster und Türen aus Hart-PVC. Bodenbeläge kamen gerade einmal auf 2.910 t.
Glossar
•Additive: Zusatzstoffe, die PVC und anderen Kunststoffen bestimmte Materialeigenschaften verleihen oder verbessern sollen - zum Beispiel Weichmacher für die Elastizität, Stabilisatoren oder Füllstoffe
•EPD: Die Environmental Product Declaration (Umwelt-Produktdeklaration) stellt Umweltwirkungen eines Produktes transparent und neutral dar, idealerweise für dessen gesamten Lebensweg.
•EVA: Co-Polymer aus Ethylen-Vinylacetat,
thermoplastisches Elastomer
•Green Deal: Klima- und Umweltschutzprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050
•Monomer: Einzelmolekül, das sich zu Polymeren verbinden kann
•PET: Polyethylenterephthalat - thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester, häufig eingesetzt für Lebensmittelverpackungen und Textilien
•Phthalate: Weichmacher für Kunststoffe
•Polymer: Chemische Verbindungen aus Einzelmolekülen
•Polyolefin: Thermoplastisches Polymer - leicht zu verarbeiten, mengenmäßig die größte Kunststoff-Gruppe
•Polyproplyen: Thermoplastisches Polymer aus der Polyolefin-Gruppe
•PVC: Polyvinylchlorid - thermoplastisches Polymer, wird erst durch Weichmacher elastisch und formbar, drittwichtigster Kunststoff
•PU: Polyurethan - Kunststoff, hergestellt aus Isocyanat, vielseitig einsetzbar, häufig auch als Beschichtung
•XPE: Vernetztes Polyethylen
Fazit des PVC-Roundtable
•Wichtig: Nicht nur auf "Design for Recycling" achten, sondern auch auf "Design for Circularity".
•Eine Lösung könnte eine Produktregistrierung/Kennzeichnung sein.
•Kreislauffähigkeit ist der Maßstab.
•Aufschläge für nicht recyclingfähige Produkte anregen.
•Rücknahmekonzepte können schlecht von ausländischen Wettbewerbern kopiert werden.
•Die Rückgabe muss einfach sein, existierende Rücknahmeysteme sind zu kompliziert.
•Die Entsorgung für Bodenbeläge teurer, die Rückgabe hingegen attraktiver und leichter machen.
Teilnehmer
•Thorsten Beinke, Decor Director modulare Beläge Tarkett
•Bas Dijkhuis, Leiter Qualitätskontrolle Tapetenfabrik Rasch
•Ullrich Eitel, Geschäftsführender Gesellschafter Marburger Tapetenfabrik
•Dr. Thomas Hohberg, Vertriebsleiter OEM/Bodensysteme Windmöller
•Volker Kettler, Leitung Produktmanagement und Produktentwicklung Meisterwerke
•Oliver Kluge
•Edwin Lingg, Geschäftsführer Lico
•Bernhard Lübbers, Objekteur
•Christian Schwöppe, Head of Research & Development Tapetenfabrik Rasch
•Sebastian Wendel, Strategische Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeitsbeauftragter Classen-Gruppe
•Prof. Dr. Helmut Maurer, ehemals EU-Kommission
•Karl-Heinz Scholz, S & P Consultants

 aus FussbodenTechnik 05/22 (Bodenbeläge)
aus FussbodenTechnik 05/22 (Bodenbeläge)
"Es muss weh tun – und alle müssen betroffen sein"
Vor dem Hintergrund ihrer Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit nimmt die Europäische Union nach 30 Jahren wieder PVC ins Visier. Über die Auswirkungen auf die Bodenbelagsbranche, Materialalternativen sowie Konzepte für Recycling und Kreislaufwirtschaft diskutierten auf Einladung des SN-Verlags Vertreter der EU, der Industrie und des Verlegehandwerks.Die Europäische Kommission hat im Herbst 2020 die Chemikalienstrategie für eine nachhaltigere und schadstofffreie Umwelt verabschiedet. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollen sie in den kommenden Jahren umsetzen. In diesem Zusammenhang werden chemische Stoffe und Stoffgruppen auf mögliche umwelt- und/oder gesundheitsgefährdende Eigenschaften unter die Lupe genommen. Nach 30 Jahren steht damit auch PVC wieder auf dem Prüfstand. Eine von der EU in Auftrag gegebene Studie befasst sich ausführlich mit dessen Produktion, Absatz, Recycling - und Risikofaktoren.
Was bedeutet das für unsere Branche? PVC spielt eine große Rolle bei Bodenbelägen und noch viel mehr bei Tapeten, wo der Werkstoff mit weitem Abstand dominiert. Der SN-Verlag Hamburg, in dem auch FussbodenTechnik erscheint, lud daher zu einer Expertenrunde ein, in der Vertreter der EU, der Industrie und des Verlegehandwerks die Studie, mögliche Auswirkungen und Lösungsansätze wie Materialalternativen, Produktdeklarationen, Recycling- und Kreislaufkonzepte erörterten. Denn all dies kann auf die Hersteller, Verarbeiter und Inverkehrbringer von chemischen Produkten zukommen.
Eingangs gab Branchenkenner Karl-Heinz Scholz (S & P Consultants), der im Bodenbelagsbereich nicht nur verschiedene Führungspositionen bekleidete, sondern auch Produktpatente hält, einen Überblick über die PVC-Diskussion in der Bauwirtschaft (Zusammenfassung siehe Kasten auf Seite 152). Prof. Dr. Helmut Maurer, von 2002 bis Juli 2022 in der EU-Kommission mit Abfall, Chemikalien, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit befasst, stellte die PVC-Studie der EU vor (Zusammenfassung siehe Kasten unten auf dieser Seite). Deren Hintergrund ist der "Green Deal", den die EU 2019 verabschiedet hat - mit dem Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.
PVC-Studie der EU
stößt auf Widerspruch
Die Abhandlung selbst stieß in der Runde auf große Kritik. Der Chemiker Dr. Thomas Hohberg vom Bodenbelagshersteller Windmöller beurteilte sie "aus wissenschaftlicher Sicht als schwach, fehlerhaft und schlecht recherchiert". An vielen Stellen fehlten "Hand und Fuß". Exemplarisch verwies Hohberg auf eine Liste der Inhaltsstoffe von PVC, die nicht mehr bzw. nie im Einsatz gewesen seien. Edwin Lingg, Gründer und Geschäftsführer des Bodenbelagsherstellers Lico, pflichtete dem bei: "Mindestens 70 % der aufgeführten Komponenten werden seit zehn Jahren nicht mehr für Bodenbeläge verwendet."
Ullrich Eitel, Geschäftsführender Gesellschafter der Marburger Tapetenfabrik, zweifelte die prognostizierte Verdoppelung des PVC-Verbrauchs bis 2050 an: "Das ist zu kurz gedacht. Weil wir eine Marktwirtschaft haben. Wir erleben ja gerade, das alles, was vor Wochen richtig war, nun nicht mehr stimmt. Vieles verändert sich durch den Ukraine-Krieg, viele Fragen stehen im Raum, die wichtiger zu beantworten sind als die Frage nach PVC.
PVC verfüge über viele gute Gebrauchseigenschaften, zum Boom von PVC-Produkten dürfte jedoch im wesentlichen auch der günstige Preis beigetragen haben, wurde bei der Diskussion betont - das sei bei Bodenbelägen nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber in der Tendenz ähnlich. Edwin Lingg, der eine Vielzahl an Produkten auf unterschiedlicher Materialbasis produziert, sagte: "Wir investieren 80 % unserer Entwicklungskosten in Naturböden, leben aber zu 90 % vom PVC. PVC ist im Preis-Leistungs-Verhältnis weit voraus, keiner unserer anderen Beläge kommt dort heran." Nach seiner Beobachtung sei PVC oft "emotional belastet": "Ich bin mir gar nicht so sicher, ob PVC wirklich so schlecht ist und andere Kunststoffe gut." Auch Thorsten Beinke von Tarkett warnte davor, "PVC pauschal in die schlechte Ecke zu stellen".
Aus Sicht von Dr. Thomas Hohberg habe PVC vor allem ein Additiv-Problem: "Wir haben gelernt, dass die Additive, vor allem die Weichmacher, im PVC Wirkungen haben, von denen man früher nichts gewusst hat. Aber daran wird seit Jahrzehnten vom Gesetzgeber und der Industrie gearbeitet und die kritischen und toxischen Stoffe sind nicht mehr im Einsatz." Für Volker Kettler, den Leiter des Produktmanagements und der Produktentwicklung der Meisterwerke, sei das Thema Weichmacher gar nicht mehr so brisant: "Die heutigen PVC-Beläge enthalten weniger Weichmacher als früher. Abgesehen davon sind ca. 50 % der Absatzmenge inzwischen ohnehin Rigid-Böden, die zu großen Teilen aus PVC und Füllstoffen bestehen. Weichmacher sind darin nur noch in geringem Umfang vorhanden."
PVC-Alternativen
für Bodenbeläge
Ist PVC also alternativlos? Bei Bodenbelägen sei das Spielfeld deutlich groß und es gebe bereits diverse PVC-freie Alternativen, wurde bei der Diskussion deutlich. Windmöller beispielsweise setzt auf Polyurethan (PU): "Das sind inzwischen unsere wichtigsten Produkte, mit denen wir über 50 % des Umsatzes erzielen", sagte Dr. Thomas Hohberg. "Unser PU basiert rohstoffseitig auf Rhizinusöl und ist durchaus im Commercial-Bereich im Einsatz, auch in anspruchsvollen Objekten wie Krankenhäusern. Wir sind davon überzeugt, dass dies die richtige Lösung ist."
Auf einen anderen Werkstoff, nämlich Polypropylen, das zur Polyolefin-Gruppe gehört, baut Classen. Das Unternehmen, ursprünglich Laminathersteller, ist vor sieben Jahren mit Polymermaterialien gestartet: "Wir haben damit zunächst eine Schlappe hingelegt. Erst mit der zweiten Generation sind wir durchgestartet", bekannte Sebastian Wendel, Leiter der Strategischen Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeitsbeauftragter, offen. Die komplette Belagskonstruktion einschließlich des integrierten Trittschalls werde aus der Polyolefin-Gruppe gefertigt - u. a. erleichtere dies das Recycling: "Wir können Sekundärrohstoffe aufnehmen, die im Markt vorhanden sind, zum Beispiel aus der Verpackungsindustrie."
Alle Anwesenden sind gegen
ein generelles PVC-Verbot
Gegen ein generelles Verbot von PVC sprachen sich alle Teilnehmer des Roundtable aus. Welche Möglichkeiten gebe es dann, mit der EU-Chemikalienstrategie konform zu gehen? Edwin Lingg plädierte für eine Regulierung via CO2-Abgabe als "ideales, faktenbelegtes Instrument". Über die Umweltsteuer, die die CO2-Emissionen bepreist, sollen Verbraucher und Unternehmen zum Umstieg auf klimafreundliche Lösungen bewegt werden. "Und wenn das Geld kostet, macht sich jeder ernsthaft Gedanken und sucht nach einer Lösung", war Lingg überzeugt. "Es muss weh tun - und es muss gleich verteilt sein. Dann betrifft es uns alle und dann wird sich auch etwas ändern."
Prof. Dr. Helmut Maurer stellte ein Produktregistrierungskonzept in den Raum, in dem alle ökologisch und gesundheitsrelevanten Faktoren benannt und quantifiziert werden. Die Idee ist nicht neu: Umwelt-Produktdeklaration (EPD) und Ökobilanzen gehen in diese Richtung. Dr. Thomas Hohberg sah die Bodenbelagsindustrie hier als Vorreiter: "Wir haben das praktisch für alle unsere Produkte vorliegen und jeder kann nachschauen, wie hoch der CO2-Fußabdruck oder der Energiebedarf sind." Nachteil: Vergleiche seien schwierig. Sebastian Wendel hielt EPDs auch nur bedingt für geeignet: "Der Architekt kann etwas damit anfangen, aber Endverbraucher nicht. Das ist nicht so leicht verständlich wie beim Kühlschrank mit A+ und A++."
Dafür brachte Wendel die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) ins Spiel. Prof. Maurer bewertete sie als "Ansatz, der halbwegs funktioniert, aber falsch ist", weil sie in Wahrheit keine Verantwortung des Herstellers für seine Produkte sei, sondern nur für den Abfall: "Eine Art Ablasshandel." Der richtige Weg wäre für Maurer, "an der Quelle zu beginnen und die Hersteller zu einer nachhaltigen Produktion zu verpflichten." Für Wendel erfülle Classen diese Anforderungen bereits: "Eigentlich haben wir alles richtig gemacht: Kein PVC, ein Produkt auf einer durchgängigen Stoff-Basis, zu 100 % recycelbar und 25 % Anteil Recyclingmaterial." Er wünschte sich von der EU entweder einen Anreiz und Unterstützung für die Industrie, die sich für nachhaltige, recycelbare Produkte engagiert oder andersherum eine Sanktionierung bzw. Abgabe für nicht Recycelfähiges.
PVC-Recycling ist mit
Herausforderungen verbunden
Nun sei es nicht so, dass PVC nicht recycelfähig sei - es lasse sich durch die thermoplastischen Eigenschaften sogar sehr gut recyceln, sagte Dr. Thomas Hohberg, was Thorsten Beinke vom großen PVC-Verarbeiter Tarkett unterstrich: "Monomere, sprich homogene PVC-Beläge, können wir im Prinzip sogar in den Farben recyceln." Auch Edwin Lingg steuerte Praxiswissen bei: "Wir recyceln unsere PVC-Böden zu 100 % ohne downzugraden. Wir machen genau dasselbe Produkt wieder daraus. Das funktioniert sogar relativ einfach." Wobei Recycling nicht gleich Recycling ist. Kann man bei Verschnittresten von der Baustelle von Recycling sprechen? Ja. Bei Post Consumer-Abfällen, sprich Altbelägen? Auf jeden Fall. Bei Randabschnitten aus der Produktion? Nach aktueller Definition nicht mehr.
Eine Herausforderung beim Recycling sind die Inhaltsstoffe des PVC: Laut Beinke können sie inzwischen auch bei verlegter Ware mittels Scantechnik identifiziert werden. Hohberg kannte allerdings noch keine "vernünftige Methode, um Weichmacher oder Blei-Additive zu separieren. Es gibt wissenschaftliche Ansätze, aber noch ist nichts spruchreif". Und nur eine Planke mit einem kritischen Weichmacher könne beim Recycling eine ganze Charge kontaminieren.
Eine weitere Herausforderung ergebe sich bei Multilayer-Böden durch die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe: "Für mich ist es eine Todsünde, eine PVC-Decklage mit einem Holzwerkstoffträger zusammenzubringen. Daraus kann man gar nichts mehr machen", sagte Volker Kettler von den Meisterwerken. Dem widersprach Lico-Geschäftsführer Edwin Lingg vehement: Das sei sogar relativ einfach zu trennen. Sebastian Wendel sprang Kettler bei und hielt besonders Konstruktionen mit integriertem Trittschall aus XPE, EVA oder Kork für problematisch: "Das passt dann nicht mehr so gut im Recycling." Hier hielt Lingg ebenfalls dagegen: "Auch das ist nicht schwierig. Es hängt vom Aufbau des Belags ab: Wenn man von vornherein weiß, dass die einzelnen Schichten wieder voneinander getrennt werden sollen, kann man das steuern, indem man sie zum Beispiel mit einem Kleber verbindet, der bei 70 °C wieder anlöst. Wir sind heute schon viel weiter, was die Trennung von Materialien betrifft. Ich bin überzeugt, dass es auch Technologien gibt, mit denen man den Bodenbelagskleber und den Zement trennen kann."
Wendel warb grundsätzlich für mehr Schulterschluss in der Industrie: "Wenn wir anfangen in einer Dimension zu denken, ,Design for Recycling’ und eventuell noch eine entsprechende Verpflichtung kommt, sind wir ein ganzes Stück weiter." Kettler brachte noch eine andere Perspektive ein: "So wie augenblicklich die Rohstoffpreise explodieren, ist das ein sehr viel wirksameres Mittel im Sinne der Ressourcenschonung und Nutzung von Sekundärrohstoffen. Das wirkt wie ein Katalysator. Jedes Gramm Abfall wird nicht mehr leichtfertig weggeworfen, sondern zurück in den Produktionsprozess geführt werden."
Kreislaufwirtschaft
aus Sicht der Industrie
Volker Kettler ging noch über das Recycling hinaus: "Die Materialität ist nicht das Maß der Dinge, sondern die Zirkularität." Er mahnte: "Bitte nicht Recycling mit Zirkularität verwechseln. Das sind zwei ganz verschiedene Themen. Zirkularität bedeutet Abfallvermeidung, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Recycling ist ein Mittel zum Zweck." Er könne sich vorstellen, dass Produktkreisläufe in der Branche funktionieren könnten - "wenn wir Produktcluster bilden und die Gruppen groß genug sind. Aber bei Exotenprodukten wird es schwierig".
Sebastian Wendel war skeptischer - vor allem, was die Logistik betrifft: "Ich persönlich glaube nicht daran, dass die Bodenbelagsindustrie es schafft, in dieser Mannigfaltigkeit die Produkte zurückzunehmen. Nicht in unserem globalen Markt. Wer will denn einen Bodenbelag aus den USA nach Deutschland zurückführen? Sie müssten vor Ort recyclingfähig sein, zum Beispiel über die lokalen Wertstoffhöfe."
Edwin Lingg konterte: "Wieso soll das nicht funktionieren? Wir bieten das mit unserem Second Life-Konzept an. Wir bezahlen jeden m2 Fußboden, den man uns zurückgibt und machen daraus einen komplett neuen. Und wenn das mehr Altböden werden, werden wir eine eigene Sparte aufbauen, die sich darum kümmert." Aber die EU müsse das steuern: "Wenn Produkte 20.000 km über den Ozean transportiert werden, mehr CO2 erzeugen und die Umwelt mehr belasten, muss das etwas kosten."
Die Meisterwerke haben ebenfalls ein Rücknahme- und Recyclingkonzept für Rigid-Designböden entwickelt: "Wir organisieren die gesamte Prozesskette, angefangen von der Bereitstellung der Sammelboxen bei Fachhändlern bis zum Rücktransport mit unseren eigenen Lkw", erläuterte Kettler. Dabei gebe es allerdings einige bürokratische Hürden zu überwinden: Unter anderem gelten Altbeläge als Abfall und seien daher in der Transportmenge auf 800 kg beschränkt. Voraussetzung für ein funktionierendes System sei zudem, dass die Kunden mitspielten und große Vertragshändler eingebunden werden könnten. Wendels Zweifel blieben: "Ich halte eine Organisation der Warenströme in Europa trotzdem für zu aufwendig und zu teuer - von Übersee gar nicht zu reden. Dann müssten auch die ganzen asiatischen Anbieter ihre Ware zurücknehmen, oder zumindest die europäischen Importeure."
Karl-Heinz Scholz mahnte davor, sich zu lange Zeit für Lösungsüberlegungen zu lassen. Die Wettbewerber im asiatischen Raum seien schnell und effizient und würden kurzfristig auf Marktveränderungen und -anforderungen reagieren. China-Kenner Oliver Kluge, der seit über 30 Jahren dortige Produktionen kennt und verfolgt, sagte: "Ich kann unterstreichen, dass es hier eine absolute Notwendigkeit gibt. In China wird derzeit intensiv diskutiert, was als Nächstes kommen wird und dabei sind PVC-freie Beläge ein großes Thema. Und ich glaube, bei der Geschwindigkeit, die die Chinesen in der Vergangenheit vorgelegt haben, brauchen wir nicht zu diskutieren, dass etwas in der Richtung kommen wird. Das heißt, wenn wir in Europa nicht alle zusammen - Industrie, Verarbeiter und auch Gesetzgeber - etwas etablieren, sieht die Zukunft düster aus." Scholz schloss sich dem Warnruf an: "Wir müssen jetzt beginnen, Konzepte zu entwickeln, die nicht so einfach zu kopieren sind. Die können nicht rein produkt- bzw. materialbezogen sein, aber zum Beispiel wären Rücknahmesysteme eine Option."
Kreislaufwirtschaft aus
Sicht des Verarbeiters
Was denkt die Verarbeiterseite darüber? Die Expertise aus der Praxis kam von Bernhard Lübbers. Der Objekteur mit Stammsitz in Hamburg und Niederlassung in Berlin stattet Büros, Hotels, Wohnanlagen und Schiffe in ganz Deutschland schlüsselfertig aus. Mit der Entsorgung von Altbelägen habe sein Betrieb in der Regel wenig zu tun, bei größeren Projekten werde dies vom Auftraggeber meist an Abbruchunternehmen ausgeschrieben, "die lediglich prüfen, ob Asbest oder PAK-Anhaftungen vorhanden sind und die Altbeläge dann als Müll in die Verbrennung geben." Lübbers selbst überlässt die Deinstallation auch einem professionellen Entsorger. Die Entsorgung sei mit Kosten von ca. 60 Cent/m2 aktuell die günstigere und einfachere Lösung gegenüber einer Rückgabe: "Das ist viel zu billig - und es ist viel zu aufwendig, ein Produkt dem Recycling oder einer Zweitverwertung zuzuführen."
Für Letzteres gab Lübbers ein Beispiel: So verspreche etwa ein Bodenbelagshersteller die Rücknahme seiner Paletten - sofern sie trocken gelagert, zu maximal acht übereinander gestapelt, mit Verzurrgurten versehen und in Folie verpackt seien. Außerdem müsse die Abholung 14 Tage im Voraus bestellt werden. Lübbers meinte: "Schon nach dem vierten Punkt ist das zu kompliziert, geschweige denn wirtschaftlich darstellbar." Und: "Aber wir Kunden bezahlen mit jedem Kilo Spachtelmasse und Kleber die theoretische Entsorgung." Lübbers nüchternes Fazit lautete: "Es gibt kein Rücknahmesystem, das funktioniert."
Doch übte der Objekteur nicht nur Kritik, sondern steuerte auch konstruktive Vorschläge bei: "Ich glaube, das Thema muss für Bodenbeläge ganz anders aufgefasst werden. Entsorgung muss teurer und die Rückgabe attraktiv und leichter gemacht werden." Die Voraussetzungen dafür seien vorhanden. "Wir haben die Produkte und die Infrastruktur durch ein dichtgestreutes Händlernetz. Organisieren lässt sich alles über eine App. Digitale Systeme erleichtern die entsprechende Kommunikation und Dokumentation." Zugleich sah Lübbers darin wie Karl-Heinz Scholz eine Chance für die europäische Industrie, mit einem "intelligenten System und intelligenten Marketing ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, das asiatische Anbieter nicht kopieren können. Unsere Dienstleistung wird wertvoller, und wir können die Wertschöpfungskette gegenüber ausländischen Anbietern von Billigprodukten sauber halten, weil es ein Konzept ist."
Prof. Dr. Helmut Maurer zur PVC-Studie der EU
"PVC-Alternativen sind reichlich vorhanden"
Die EU hat eine umfassende Studie über PVC aufgelegt, die den Werkstoff kritisch beleuchtet. Die Ergebnisse fasste Prof. Dr. Helmut Maurer beim Roundtable des SN-Verlags folgendermaßen zusammen:
- PVC als Material: PVC ist ein kostengünstiges Polymer mit vielen Additiven - insgesamt ca. 370, davon hauptsächlich Stabilisatoren und Weichmacher. Die meisten können dazu neigen, zu migrieren: zum Beispiel in die Haut, Atemluft und Grundwasser. Grundsätzlich herrschten Datenlücken zu Migration und Bioverfügbarkeit von Additiven.
-PVC-Produktion: Weltweit würden ca. 60 Mio. t PVC produziert, davon rund 50 % in China (steigend) und 10 % in der EU (fallend) mit Deutschland und Frankreich als größten Produzenten. Wichtigster Markt sei ebenfalls China. Die Nachfrage nach PVC nehme auch aus anderen Ländern zu, daher prognostiziert die Studie eine Verdoppelung des Verbrauchs bis 2050 - mit entsprechenden Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß.
-PVC-Entsorgung: Nach Zahlen des Netzwerks Vinylplus fielen 2020 ca. 2,9 Mio. t Post-Consumer-PVC-Abfälle an. Gut die Hälfte davon wurde zur Energiegewinnung verbrannt, jeweils ca. 25 % deponiert und recycelt (730.000 t). Risiken sieht die EU-Studie bei der energetischen Verwendung von PVC-Abfällen, durch die Verbrennung im Freien sowie in der illegalen Entsorgung und illegalen Verbringung unter falscher Deklaration. Die Daten zu PVC-Abfallmengen und -entsorgung seien unzureichend.
-PVC-Recycling: Ca. 730.000 t würden jährlich recycelt, überwiegend Hart-PVC. Alte Additive stellten ein Problem dar, Dekontaminierungsverfahren fehlten. Zudem sei Recycling ein Herstellungsprozess und als solcher energieintensiv und mit Emissionen verbunden. Und: In der Regel finde ein Downcycling statt. Nur 7 bis 9 % Alt-PVC würden adäquat zu Virgin-PVC in den Kreislauf zurückgeführt.
-PVC-Alternativen: Diese seien reichlich vorhanden - vor allem andere Kunststoffe, Metall und Holz. Ihre Verwendung würde Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen verringern.
-PVC-Ausstiegsszenarien: Diese seien noch offen. Die Daten zu einer Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen seien unzureichend. In der Automobilindustrie und im Bauwesen habe allerdings bereits der Ausstieg aus der Verwendung von PVC begonnen.
Karl-Heinz Scholz über die PVC-Diskussion in der Bauindustrie
"Keine Lösung für die sach- und umweltgerechte Entsorgung von PVC-Belägen"
Polyvinylchlorid (PVC) wurde in den 1910er-Jahren entwickelt und erlebte bis Anfang der 1990er-Jahre einen unaufhaltsamen Aufstieg. Dann geriet der Massenkunststoff wegen umwelt- und gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe (Chlor, Schwermetalle und Weichmacher) in die Kritik und wurde in einigen Kommunen verboten. Im Jahr 2000 stand er vor einem generellen Verbot, was von der einschlägigen PVC-Industrie nur durch eine freiwillige Selbstverpflichtung verhindert werden konnte. Sie gründete das Vinylplus-Programm, mit dem ein langfristiger Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte PVC-Wertschöpfungskette geschaffen werden sollte. 2001, 2010 und 2021 wurden jeweils Zehn-Jahres-Ziele für die Herstellung von PVC, Additiven, Entsorgung bzw. Recycling sowie Forschung und Entwicklung festgelegt.
Bis 2020 sollten unter anderem die jährliche PVC-Recyclingmenge auf 800.000 t steigen (2025: 900.000 t, 2030: 1 Mio. t), der nachhaltige Einsatz von Additiven gefördert, die Nachhaltigkeit von PVC-Produkten verbessert, CO2-Emissionen, Energie- und Ressourcenverbrauch schrittweise reduziert werden. Tatsächlich wurden 2020 über 730.000 t PVC recycelt, aber das waren hauptsächlich Fenster und Türen aus Hart-PVC. Bodenbeläge kamen gerade einmal auf 2.910 t.
Glossar
•Additive: Zusatzstoffe, die PVC und anderen Kunststoffen bestimmte Materialeigenschaften verleihen oder verbessern sollen - zum Beispiel Weichmacher für die Elastizität, Stabilisatoren oder Füllstoffe
•EPD: Die Environmental Product Declaration (Umwelt-Produktdeklaration) stellt Umweltwirkungen eines Produktes transparent und neutral dar, idealerweise für dessen gesamten Lebensweg.
•EVA: Co-Polymer aus Ethylen-Vinylacetat,
thermoplastisches Elastomer
•Green Deal: Klima- und Umweltschutzprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050
•Monomer: Einzelmolekül, das sich zu Polymeren verbinden kann
•PET: Polyethylenterephthalat - thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester, häufig eingesetzt für Lebensmittelverpackungen und Textilien
•Phthalate: Weichmacher für Kunststoffe
•Polymer: Chemische Verbindungen aus Einzelmolekülen
•Polyolefin: Thermoplastisches Polymer - leicht zu verarbeiten, mengenmäßig die größte Kunststoff-Gruppe
•Polyproplyen: Thermoplastisches Polymer aus der Polyolefin-Gruppe
•PVC: Polyvinylchlorid - thermoplastisches Polymer, wird erst durch Weichmacher elastisch und formbar, drittwichtigster Kunststoff
•PU: Polyurethan - Kunststoff, hergestellt aus Isocyanat, vielseitig einsetzbar, häufig auch als Beschichtung
•XPE: Vernetztes Polyethylen
Fazit des PVC-Roundtable
•Wichtig: Nicht nur auf "Design for Recycling" achten, sondern auch auf "Design for Circularity".
•Eine Lösung könnte eine Produktregistrierung/Kennzeichnung sein.
•Kreislauffähigkeit ist der Maßstab.
•Aufschläge für nicht recyclingfähige Produkte anregen.
•Rücknahmekonzepte können schlecht von ausländischen Wettbewerbern kopiert werden.
•Die Rückgabe muss einfach sein, existierende Rücknahmeysteme sind zu kompliziert.
•Die Entsorgung für Bodenbeläge teurer, die Rückgabe hingegen attraktiver und leichter machen.
Teilnehmer
•Thorsten Beinke, Decor Director modulare Beläge Tarkett
•Bas Dijkhuis, Leiter Qualitätskontrolle Tapetenfabrik Rasch
•Ullrich Eitel, Geschäftsführender Gesellschafter Marburger Tapetenfabrik
•Dr. Thomas Hohberg, Vertriebsleiter OEM/Bodensysteme Windmöller
•Volker Kettler, Leitung Produktmanagement und Produktentwicklung Meisterwerke
•Oliver Kluge
•Edwin Lingg, Geschäftsführer Lico
•Bernhard Lübbers, Objekteur
•Christian Schwöppe, Head of Research & Development Tapetenfabrik Rasch
•Sebastian Wendel, Strategische Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeitsbeauftragter Classen-Gruppe
•Prof. Dr. Helmut Maurer, ehemals EU-Kommission
•Karl-Heinz Scholz, S & P Consultants

Foto/Grafik: Tarkett
Hersteller von PVC-Böden setzen auf das Recycling von Altbelägen – etwa Tarkett mit seinem Rücknahme-Programm "Restart".

Foto/Grafik: Classen
Gutes Beispiel aus der Industrie: Der Classen-Gruppe dienen ausgediente und aufbereitete Plastikverpackungen als Basis für ihren selbst entwickelten und
PVC-freien Werkstoff Ceramin (Foto), aus dem im Upcycling u. a. neue Bodenbeläge hergestellt werden.
PVC-freien Werkstoff Ceramin (Foto), aus dem im Upcycling u. a. neue Bodenbeläge hergestellt werden.

Foto/Grafik: AgPR
Die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR) betreibt in Troisdorf eine Recyclinganlage.
