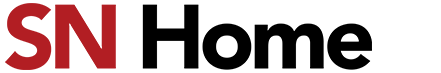
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
Fachanwalt Andreas Becker informiert
Der Handwerker hat bei einem Baustillstand das Problem, dass zum einen die Kapazitäten seines Betriebs für den Leistungszeitraum freigehalten werden und bei einer Verschiebung eventuell zwei Bauvorhaben zum selben Zeitpunkt ausgeführt werden müssten. Zum anderen können Materialpreise und auch Lohnkosten in der Zwischenzeit steigen. Die Ausführung der Leistung zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt kann deshalb unwirtschaftlich werden.
Bei VOB-Verträgen gibt es für diesen Fall eine Lösung: Nach §6 Abs.7 VOB/B kann nach einer Unterbrechung der Tätigkeit, die länger als dreiMonate dauert, jede Partei, also der Auftraggeber und der Auftragnehmer, eine Kündigung des Werkvertrages aussprechen. Von einer solchen Unterbrechung ist auch auszugehen, wenn die Leistung zum vorherigen Zeitpunkt noch nicht begonnen werden kann. Das heißt, wenn ein Baubeginn mit einem festen Datum oder einem Zeitraum vereinbart ist, zu diesem Zeitpunkt die Leistung allerdings nicht begonnen werden kann und auch in den nächsten dreiMonaten nicht begonnen wird, ist eine Kündigung möglich. Dabei wird sowohl die Unterbrechung während der Ausführung der Tätigkeiten wie auch der verzögerte Baubeginn erfasst.
Behinderungsanzeige
grundsätzlich schriftlich
Ratsam ist es hier, jeweils eine Behinderungsanzeige nach §6 Abs. 1VOB/B zu schreiben. Die Behinderungsanzeige muss schriftlich erfolgen. In diese Behinderungsanzeige sollte aufgenommen werden, dass es einen festen Termin für die Erstellung des Bauvorhabens gibt, dass eine Arbeit nicht möglich ist und weiterhin auch schon Mehrkosten pauschal angekündigt werden. Eine Kündigung kann auch ausgesprochen werden, vor Ablauf der Dreimonatsfrist, wenn feststeht, dass die Unterbrechung mehr als drei Monate dauern wird. Eine Kündigung ist möglich, wenn es einer Partei nicht zumutbar ist, am Vertrag festzuhalten.
Die Regelung des §6 Abs.7 VOB/B macht hier keine Unterscheidung nach der jeweiligen Risikosphäre, aus der der Behinderungsgrund kommt. Es gibt auch kein Verschulden. Es reicht die Tatsache einer Unterbrechung von mehr als dreiMonaten. Die Partei muss danach prüfen, ob ein Festhalten am Vertrag zumutbar ist. Wenn zum Beispiel der Auftraggeber oder Auftragnehmer schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis davon hat, dass die Unterbrechung länger als dreiMonate dauert, oder dass mit einer solchen Unterbrechung zu rechnen ist, ist ein Festhalten am Vertrag zumutbar.
Das Kündigungsrecht muss auch nicht sofort nach Ablauf der dreiMonate ausgeübt werden. Nach dem Ablauf dieses Zeitraums ist keine Partei gezwungen, am Vertrag festzuhalten. Aus diesem Grund kann der Ablauf der Dreimonatsfrist dazu genutzt werden, eine neue Vergütungsvereinbarung abzuschließen, anstatt zu kündigen. Dies dürfte für viele Auftragnehmer eine gute Möglichkeit sein, die Mehrkosten, die zum Beispiel durch Lohnerhöhungen oder Materialpreisverteuerungen entstehen, an den Auftraggeber weiterzugeben. Zum Zeitpunkt der Kündigung muss die Unterbrechung noch andauern.
Wird also nach mehrmonatiger Unterbrechung die Fortführung der Arbeiten möglich, kann nicht allein wegen des zurückliegenden Dreimonatszeitraums gekündigt werden. Wobei die Weiterarbeit in einem relativ kurzen Zeitraum möglich sein muss. Es reicht, je nach Bauvorhaben, nicht aus, wenn ein neuer Terminplan vorgelegt wird, der die Arbeit in mehreren Monaten möglich macht.
Anspruch auf
Entschädigung
Für den Zeitraum der Behinderung, das heißt, nachdem eine Behinderungsanzeige abgegeben worden ist, steht dem Betrieb ein sogenannter Entschädigungsanspruch zu. Dieser Entschädigungsanspruch beinhaltet die Kosten der Wartezeit, die bis zur Kündigung oder bis zum Bauvorhaben entstanden sind. Dies werden regelmäßig Kosten sein für das Einlagern von Material, unnütze Lohnkosten, beziehungsweise sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Baustelle gemacht worden sind. Nicht davon erfasst sind Mehrkosten, die nach dem Ende einer Wartezeit entstehen.
Das heißt, eine Materialpreisverteuerung oder der Einsatz eines teureren Subunternehmers ist von einer solchen Entschädigung nicht gedeckt. Das heißt weiter, auch nach einer Baubehinderung, die zu einer Materialpreisverteuerung geführt hat, besteht im Regelfall keine Erstattung der Mehrkosten für das teurere Material.
Geschieht nichts,
läuft die Dreimonatsfrist
In einem Fall hatte ein Auftraggeber mit dem Auftragnehmer Streit über die Wirksamkeit einer nach §6 Abs.7 VOB/B ausgesprochenen Kündigung. Der Auftragnehmer war beauftragt, Umbauarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten sollten am 20. April beginnen. Zur Durchführung der Arbeiten wäre jedoch noch ein weiteres Gerüst notwendig gewesen, das auf das bereits bauseits gestellte Flächengerüst aufgestellt werden müsste. Es entstand Streit darüber, ob das Gerüst benötigt würde - und wenn ja, wer das Gerüst zu stellen hätte.
Der Auftragnehmer meldete daraufhin am 20. Juni eine Baubehinderung an. Die Parteien vereinbarten, dass der Auftraggeber das Gerüst entsprechend den Vorgaben des Auftragnehmers errichtet. Der Auftragnehmer erhob Bedenken, dass das Gerüst nicht den Lastklassen, die notwendig waren, entsprechen würde. Er kündigte daraufhin am 26. Juli den Vertrag nach §6Abs.7 VOB/B.
In einer Entscheidung des Gerichts wurde die Kündigung nach §6 Abs.7 VOB/B für diesen Fall als nicht wirksam angesehen. Zwar war der Dreimonatszeitraum seit dem Beginn 20. April am 26. Juli überschritten, das Gericht hat die Vereinbarung, dass ein Gerüst gestellt wird, als eine stillschweigende Verschiebung des ursprünglichen Baubeginns angesehen. Damit war die Zeitspanne zwischen dem ursprünglichen Vertragsbeginn und dem Aufstellen des Gerüstes, hier am 14.Juni, nicht in die Dreimonatsfrist mit einzuberechnen. Das Gericht war der Auffassung, dass zum Zeitpunkt der Kündigung, die Dreimonatsfrist noch nicht verstrichen war und deshalb die Kündigung unwirksam sei.
Das zeigt, dass es nicht alleine auf den Ablauf ankommt, sondern auch auf das, was in dem Zeitraum der dreiMonate passiert. Geschieht überhaupt nichts, so läuft die Dreimonatsfrist. Wird in dieser Zeit über notwendige Voraussetzungen zum Beginn der Arbeit verhandelt, verschiebt sich einvernehmlich die Ausführungsfrist und der Dreimonatszeitraum kann damit beendet werden, beziehungsweise beginnt von Neuem.
Der Autor
Andreas Becker ist Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Bau- und Architektenrecht.
Becker-Baurecht Nienburger Str. 14a 30167 Hannover
Tel.: 0511/1231370
www.becker-baurecht.de info@becker-baurecht.de aus FussbodenTechnik 03/22 (Recht)
Kündigung bei Baustillstand ab drei Monaten möglich
Sehr oft vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer vertraglich einen Terminplan. Wenn der Leistungsbeginn heranrückt, wird oft festgestellt, dass das Bauvorhaben noch nicht so weit ist, dass die Leistungen begonnen werden können. Oftmals verschieben sich die Zeiten der Leistungsausführung um mehrere Monate. FussbodenTechnik-Autor Andreas Becker hat Tipps für diesen Fall parat.Der Handwerker hat bei einem Baustillstand das Problem, dass zum einen die Kapazitäten seines Betriebs für den Leistungszeitraum freigehalten werden und bei einer Verschiebung eventuell zwei Bauvorhaben zum selben Zeitpunkt ausgeführt werden müssten. Zum anderen können Materialpreise und auch Lohnkosten in der Zwischenzeit steigen. Die Ausführung der Leistung zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt kann deshalb unwirtschaftlich werden.
Bei VOB-Verträgen gibt es für diesen Fall eine Lösung: Nach §6 Abs.7 VOB/B kann nach einer Unterbrechung der Tätigkeit, die länger als dreiMonate dauert, jede Partei, also der Auftraggeber und der Auftragnehmer, eine Kündigung des Werkvertrages aussprechen. Von einer solchen Unterbrechung ist auch auszugehen, wenn die Leistung zum vorherigen Zeitpunkt noch nicht begonnen werden kann. Das heißt, wenn ein Baubeginn mit einem festen Datum oder einem Zeitraum vereinbart ist, zu diesem Zeitpunkt die Leistung allerdings nicht begonnen werden kann und auch in den nächsten dreiMonaten nicht begonnen wird, ist eine Kündigung möglich. Dabei wird sowohl die Unterbrechung während der Ausführung der Tätigkeiten wie auch der verzögerte Baubeginn erfasst.
Behinderungsanzeige
grundsätzlich schriftlich
Ratsam ist es hier, jeweils eine Behinderungsanzeige nach §6 Abs. 1VOB/B zu schreiben. Die Behinderungsanzeige muss schriftlich erfolgen. In diese Behinderungsanzeige sollte aufgenommen werden, dass es einen festen Termin für die Erstellung des Bauvorhabens gibt, dass eine Arbeit nicht möglich ist und weiterhin auch schon Mehrkosten pauschal angekündigt werden. Eine Kündigung kann auch ausgesprochen werden, vor Ablauf der Dreimonatsfrist, wenn feststeht, dass die Unterbrechung mehr als drei Monate dauern wird. Eine Kündigung ist möglich, wenn es einer Partei nicht zumutbar ist, am Vertrag festzuhalten.
Die Regelung des §6 Abs.7 VOB/B macht hier keine Unterscheidung nach der jeweiligen Risikosphäre, aus der der Behinderungsgrund kommt. Es gibt auch kein Verschulden. Es reicht die Tatsache einer Unterbrechung von mehr als dreiMonaten. Die Partei muss danach prüfen, ob ein Festhalten am Vertrag zumutbar ist. Wenn zum Beispiel der Auftraggeber oder Auftragnehmer schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis davon hat, dass die Unterbrechung länger als dreiMonate dauert, oder dass mit einer solchen Unterbrechung zu rechnen ist, ist ein Festhalten am Vertrag zumutbar.
Das Kündigungsrecht muss auch nicht sofort nach Ablauf der dreiMonate ausgeübt werden. Nach dem Ablauf dieses Zeitraums ist keine Partei gezwungen, am Vertrag festzuhalten. Aus diesem Grund kann der Ablauf der Dreimonatsfrist dazu genutzt werden, eine neue Vergütungsvereinbarung abzuschließen, anstatt zu kündigen. Dies dürfte für viele Auftragnehmer eine gute Möglichkeit sein, die Mehrkosten, die zum Beispiel durch Lohnerhöhungen oder Materialpreisverteuerungen entstehen, an den Auftraggeber weiterzugeben. Zum Zeitpunkt der Kündigung muss die Unterbrechung noch andauern.
Wird also nach mehrmonatiger Unterbrechung die Fortführung der Arbeiten möglich, kann nicht allein wegen des zurückliegenden Dreimonatszeitraums gekündigt werden. Wobei die Weiterarbeit in einem relativ kurzen Zeitraum möglich sein muss. Es reicht, je nach Bauvorhaben, nicht aus, wenn ein neuer Terminplan vorgelegt wird, der die Arbeit in mehreren Monaten möglich macht.
Anspruch auf
Entschädigung
Für den Zeitraum der Behinderung, das heißt, nachdem eine Behinderungsanzeige abgegeben worden ist, steht dem Betrieb ein sogenannter Entschädigungsanspruch zu. Dieser Entschädigungsanspruch beinhaltet die Kosten der Wartezeit, die bis zur Kündigung oder bis zum Bauvorhaben entstanden sind. Dies werden regelmäßig Kosten sein für das Einlagern von Material, unnütze Lohnkosten, beziehungsweise sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Baustelle gemacht worden sind. Nicht davon erfasst sind Mehrkosten, die nach dem Ende einer Wartezeit entstehen.
Das heißt, eine Materialpreisverteuerung oder der Einsatz eines teureren Subunternehmers ist von einer solchen Entschädigung nicht gedeckt. Das heißt weiter, auch nach einer Baubehinderung, die zu einer Materialpreisverteuerung geführt hat, besteht im Regelfall keine Erstattung der Mehrkosten für das teurere Material.
Geschieht nichts,
läuft die Dreimonatsfrist
In einem Fall hatte ein Auftraggeber mit dem Auftragnehmer Streit über die Wirksamkeit einer nach §6 Abs.7 VOB/B ausgesprochenen Kündigung. Der Auftragnehmer war beauftragt, Umbauarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten sollten am 20. April beginnen. Zur Durchführung der Arbeiten wäre jedoch noch ein weiteres Gerüst notwendig gewesen, das auf das bereits bauseits gestellte Flächengerüst aufgestellt werden müsste. Es entstand Streit darüber, ob das Gerüst benötigt würde - und wenn ja, wer das Gerüst zu stellen hätte.
Der Auftragnehmer meldete daraufhin am 20. Juni eine Baubehinderung an. Die Parteien vereinbarten, dass der Auftraggeber das Gerüst entsprechend den Vorgaben des Auftragnehmers errichtet. Der Auftragnehmer erhob Bedenken, dass das Gerüst nicht den Lastklassen, die notwendig waren, entsprechen würde. Er kündigte daraufhin am 26. Juli den Vertrag nach §6Abs.7 VOB/B.
In einer Entscheidung des Gerichts wurde die Kündigung nach §6 Abs.7 VOB/B für diesen Fall als nicht wirksam angesehen. Zwar war der Dreimonatszeitraum seit dem Beginn 20. April am 26. Juli überschritten, das Gericht hat die Vereinbarung, dass ein Gerüst gestellt wird, als eine stillschweigende Verschiebung des ursprünglichen Baubeginns angesehen. Damit war die Zeitspanne zwischen dem ursprünglichen Vertragsbeginn und dem Aufstellen des Gerüstes, hier am 14.Juni, nicht in die Dreimonatsfrist mit einzuberechnen. Das Gericht war der Auffassung, dass zum Zeitpunkt der Kündigung, die Dreimonatsfrist noch nicht verstrichen war und deshalb die Kündigung unwirksam sei.
Das zeigt, dass es nicht alleine auf den Ablauf ankommt, sondern auch auf das, was in dem Zeitraum der dreiMonate passiert. Geschieht überhaupt nichts, so läuft die Dreimonatsfrist. Wird in dieser Zeit über notwendige Voraussetzungen zum Beginn der Arbeit verhandelt, verschiebt sich einvernehmlich die Ausführungsfrist und der Dreimonatszeitraum kann damit beendet werden, beziehungsweise beginnt von Neuem.
Der Autor
Andreas Becker ist Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Bau- und Architektenrecht.
Becker-Baurecht Nienburger Str. 14a 30167 Hannover
Tel.: 0511/1231370
www.becker-baurecht.de info@becker-baurecht.de aus FussbodenTechnik 03/22 (Recht)
