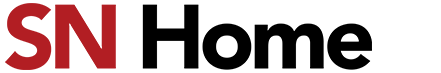
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
Fachanwalt Andreas Becker informiert: Unterschiede beim Bauvertrag nach BGB und VOB
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein von allen Beteiligten im Bauwesen erarbeitetes Regelwerk. Sie ist aber kein Gesetz und keine Rechtsverordnung. Fachanwalt Andreas Becker erklärt im folgenden Beitrag die Besonderheiten, die bei der Anwendung der VOB als Rechtsgrundlage eines Bauvertrages zu beachten sind.Grundsätzlich haben Auftraggeber und Auftragnehmer als Vertragsparteien die Möglichkeit, einen Bauwerkvertrag nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) oder nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) abzuschließen. Für den juristischen Laien sind die Unterschiede nicht zwangsläufig auf den ersten Blick erkennbar - aus rechtlicher Sicht bestehen jedoch nicht unerhebliche Unterschiede zwischen den Regelungen der VOB und des BGB.
Fall: Auftragnehmer nennt
VOB als Vertragsgrundlage
In dem vorliegenden Fall hatte ein Malerbetrieb den Auftrag für Malerarbeiten in einem Einfamilienhaus erhalten. Die Auftraggeber waren die Eigentümer der Immobilie und damit Privatkunden. Der Malerbetrieb hatte unter sein Angebot geschrieben: "Vertragsgrundlage und Grundlage der Abrechnung ist die VOB/B und VOB/C in der neuesten Fassung." Zwischen den Parteien kam es später zu einem Rechtsstreit. Das Gericht hatte dabei zu entscheiden, ob die VOB/B oder das BGB Vertragsgrundlage ist.
Soweit die Parteien eines Vertrages nichts anderes vereinbaren, gelten grundsätzlich immer die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Um die Bestimmungen des BGB wirksam vereinbaren zu können, bedarf es daher keiner besonderen Vorgehensweise. Die Parteien vereinbaren schlichtweg eine konkrete Leistungserbringung, beispielsweise die Durchführung von - wie hier - Malerarbeiten. Es finden dann automatisch die Regelungen des BGB Anwendung. Nur für den Fall, dass die Parteien abweichende vertragliche Vereinbarungen wirksam getroffen haben oder ausdrücklich die Regelungen der VOB vereinbaren, gelten diese vorrangig.
Urteil: Bloßer Hinweis auf
VOB reicht nicht aus
Die Regelungen der VOB sind sogenannte Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), da sie für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind und angewendet werden. Das Gericht hat daher entschieden, dass ein bloßer Hinweis auf die VOB/B und die VOB/C nicht ausreichend sei, um die VOB als Vertragsgrundlage zu vereinbaren. Sofern ein Auftragnehmer die VOB in dem Bauvertrag mit einem privaten Auftraggeber einbeziehen möchte, muss er diesem den Text der VOB/B aushändigen. Begründet wurde dies damit, dass der Auftraggeber nach dem Angebot die VOB/B lesen und somit Kenntnis davon erlangen kann - und dann auch entscheiden kann, ob er diese Regelungen mit in seine vertragliche Vereinbarung einbeziehen möchte.
Wenn der private Auftraggeber beim Vertragsschluss durch einen Architekten vertreten wurde, reicht es allerdings aus, wenn auf die VOB/B oder die VOB/C Bezug genommen wird. Unproblematisch kann die VOB/B auch vereinbart werden, wenn der Auftragnehmer selbst die VOB/B als Vertragsgrundlage vorschlägt. In dem vorliegenden Fall war der VOB-Text nicht übergeben und eine Vertretung durch einen Architekten hatte nicht stattgefunden. Insofern hatten die Parteien die VOB/B und VOB/C nicht vereinbart: Es galt daher sowohl als Vertragsgrundlage als auch als Abrechnungsgrundlage das Werkvertragsrecht des BGB.
Zahlreiche Vor- und Nachteile
beider Vertragswerke
Der Rechtsgrundlage VOB oder BGB kommen in mehreren Punkten erhebliche Bedeutungen zu. Es ist jedoch festzuhalten, dass es zahlreiche Vor- und Nachteile beider Vertragswerke zu benennen gibt. Ein Unterschied liegt beispielsweise darin, dass die Mängelrechte im Rahmen des BGB erst fünf Jahre nach Abnahme verjähren. Die Verjährungsfrist beim VOB-Vertrag endet bereits nach vier Jahren. Hinsichtlich der Verjährung ist für den Auftraggeber daher ein BGB-Werkvertrag zu empfehlen.
Möchte ein Bauherr eine Änderung des Bauentwurfes durchsetzen, so kann er dies jeweils per Anordnung gegenüber dem Auftragnehmer tun. Die Rechtsfolge nach § 1 Abs. 3 VOB/B ist die, dass der Auftragnehmer dieser Änderungsanordnung des Auftraggebers unverzüglich nachkommen muss. Im BGB-Vertrag ist nach § 650b BGB eine 30-tägige Verhandlungsphase vorgeschaltet.
Auch in Bezug auf die Abrechnung der Leistungen ist die Vertragsgrundlage entscheidend. Solange kein VOB/B-Vertrag vereinbart ist und auch nicht die VOB/C wirksam in die Vertragsbedingungen mit aufgenommen worden ist, ist eine Abrechnung nach den Regeln der VOB/C (z. B. Übermessensklausel) nicht möglich. Es würde dann eine Abrechnung auf Basis des Werkvertragsrechtes des BGB erfolgen, bei der beispielsweise bei Maler- oder Fassadenarbeiten jede Fenster- und Türöffnung abgezogen bzw. berücksichtigt werden muss und nicht "übermessen" wird.
Tipp: Bei Privatkunden
BGB-Verträge verwenden
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die Regelungen der VOB zu vereinbaren. Bei einem Vertragsschluss mit einem Unternehmer hat der Auftragnehmer die Wahl zwischen der VOB und dem BGB. Dem Auftragnehmer ist zu empfehlen, gegenüber dem Verbraucher lediglich BGB-Verträge zu verwenden. In jedem Fall sollte die VOB lediglich dann angewendet werden, wenn sie als Ganzes - also vollständig und ohne Ausnahmen - vereinbart worden ist. Anderweitig besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Anwendung der VOB unwirksam ist.
Der Autor
Andreas Becker ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Becker-Baurecht
Nienburger Str. 14a 30167 Hannover
Tel.: 05 11 / 12 31 37-0
www.becker-baurecht.de
info@becker-baurecht.de aus FussbodenTechnik 02/25 (Recht)
