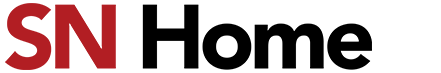
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
Innung Nordost: Herbsttagung mit imposanter Ausstellung
Nach zwei Jahren mit übervollen Auftragsbüchern ist die noch im Frühjahr herrschende Zuversicht gesunken. "Bauherren ziehen wegen steigender Preise und Zinsen ihre Aufträge zurück", beschrieb Holger Wiehle, Obermeister der Innung Nordost Parkett und Fußbodentechnik, auf der Mitgliederversammlung in Weimar die veränderte Lage. Bundesweit sei bereits ein Rückgang von 12 % zu verzeichnen. Angst breite sich aus, Sprache und Umgang würden rauer. "Aber wir Handwerker im Osten sind Krisen und Kummer gewohnt und können improvisieren", lautet seine positive Botschaft an die Kollegen.
Mit 140 Voll- und 69 Fördermitgliedern geht die Innung Nordost ins Jahr 2023. Material- und Lieferschwierigkeiten werden den Weg begleiten. Holger Wiehle erkennt aber an, "dass die Industrie die Qualität ihrer Produkte auch hinsichtlich der Zuschlagsstoffe halten will". Auch die vielen Weiterbildungsangebote direkt von Herstellern hält er für eine gute Idee, möchte Themen, die den Handwerker umtreiben, aber gemeinsam mit den Fördermitgliedern abstimmen.
Mahnende Worte zur Ausbildung
und viele Ehrungen
Wenig Antrieb attestierte Lehrlingswart Rico Zellhuber einer Reihe von Auszubildenden im zweiten Lehrjahr an der Berufsschule Plauen, weil in der jüngsten Zwischenprüfung fünf in der Praxis und fünf in der Theorie durchgefallen sind. Ein Lichtblick dagegen Franz Dybeck, der mit seinem Gesellenstück die volle Punktzahl von 100 abräumte und als Landessieger Parkett zusammen mit dem Landessieger Bodenleger, Konrad Vogel aus Berlin, geehrt wurde. Damit nicht genug der Ehrungen: Plaketten erhielten die beiden frisch gebackenen Meister Sven Hausdorf und Robert Blank, eine Urkunde für aktive 45 Jahre bekam Gerd Zellhuber und der ehemalige Bundesinnungsmeister Joachim Barth wurde, wenn auch zwei Jahre verspätet, mit dem goldenen, 50-jährigen Meisterbrief ausgezeichnet.
Sie sind Vorbild für Leute, die es in der Branche nach oben schaffen wollen. Dass zum Meisterkurs am 30. August ursprünglich 24 Gesellen Interesse bekundet hatten, dann 19 erschienen und zu Beginn der Fortbildung noch 13 übrig waren, stimmt allerdings nachdenklich. Aus Berlin hatte Robert Mutschall keine besseren Nachrichten. Die Gesellenstücke von vier Absolventen der Max-Bill-Schule seien eher anspruchslos. "Fehlende Motivation ist der Knackpunkt." Die Kritik abzumildern versuchte Peter Palme, Schulleiter am Bildungszentrum Plauen: "Wir haben keine anderen Jugendlichen und müssen es gemeinsam schaffen. Da braucht es auch soziale Kompetenz."
Achtung vor Liefermaterial
ohne CE-Kennzeichen
Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass ein Produkt den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft entspricht. Wer ein Produkt oder Material nach Europa einführt, muss dieses gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichen erwerben und nachweisen. Bei Holz ist das, wie Holger Wiehle erfuhr, nicht immer der Fall. Da hatte ein Generalunternehmer Parkett direkt auf die Baustelle liefern und vom Handwerker verlegen lassen. Als von Kundenseite die Abnahme erfolgen sollte, wurde penibel nach Fehlern gesucht. An der Verlegung gab es nichts auszusetzen, doch der kritische Blick in die Lieferpapiere des Materials fand keine CE-Kennzeichnung.
Was nun? Fakt war: Die zugesagte Eigenschaft der europäischen Zulassung war nicht eingehalten worden. Der Generalunternehmer wandte sich an seinen Lieferanten, der wiederum an den ausländischen Hersteller - und von dort kam eine sogenannte Declaration of Performance (DoP). Zwar ist die DoP-Leistungserklärung tatsächlich ein Baustein für eine CE-Kennzeichnung, bedauerlicherweise war in diesem Fall das Dokument aber knapp zehn Jahre alt und entsprach nicht mehr den aktuellen Brandschutzanforderungen. Das Ende vom Lied: Der Kunde akzeptierte diese DoP nicht, hatte aber auch kein Interesse, den gut verlegten Boden wieder herausreißen zu lassen. Ihm ging es lediglich darum, den Preis zu drücken oder gar nicht zu bezahlen.
Hätte der Parkettleger sein Material auf CE-Kennzeichnung prüfen müssen? In diesem Fall lag die Verantwortung beim Generalunternehmer. Doch bei einem Privatkunden sollte der Handwerker die europäische Konformität seines gelieferten Holzbodens selber prüfen. Normalerweise steht das CE-Zeichen auf der Verpackung. Im Zweifelsfall kann die Zulassung des Produktes beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erfragt werden. Fehlen alle Informationen, gilt es, beim Auftraggeber Bedenken geltend zu machen.
KRL-Messmethode hat jetzt eine Norm
Wenn es Zweifel an der Belegreife gibt, immer Bedenken anmelden. Vom Estrichleger kann der Parkett- und Bodenleger keine Freigabe erhalten, weder mündlich noch schriftlich. Dr. Norbert Arnold (Uzin): "Nur der, der die Rechnung zahlt, also der Vertragspartner, kann sich über Bedenken hinweg setzen und eine Freigabe erteilen."
Es sind die zementarmen, mageren Estriche, die - so prognostiziert Dr. Arnold - in Zukunft für mehr Unsicherheit hinsichtlich der Belegreife sorgen werden. Zur Messung gerade dieser Untergründe sei die KRL-Methode der CM-Messung überlegen. Warum? Weil das Wasser allein im Zement stecke, in einer 50g-Probe zur CM-Messung aber nur rund 7 g-Zement enthalten seien. Der Rest ist Sand. Gemessen wird hier also die Wassermenge anhand einer fragwürdigen Probe. Zudem, so Dr. Arnold, sei die Wassermenge das Geringste von drei Estrichkriterien, die zu Feuchtschäden führen können. Am wichtigsten sei eine offene, also wasserdurchlässige Oberfläche, an zweiter Stelle stehe der Wasserdampfdruck. Denn dieser Druck bewirke, dass Feuchtigkeit nach oben strebe. Und genau das misst die korrespondierende relative Luftfeuchte.
Warum die Überlegenheit der KRL-Methode gegenüber CM für viele schwer zu verstehen sei, erklärt Dr.Arnold anhand eines Klimavergleiches. Das Wüstenklima bei 40 °C und 20 % rLf wirke gegenüber einem 5 °C nasskalten Schmuddelwetter mit 80 % rel. F. zwar trockener, tatsächlich aber habe die Wassermenge in der Wüstenluft mehr Feuchtigkeit angereichert, als das ungemütliche Herbstwetter. Erst, wer das begreife, könne erkennen, dass bei der Estrichfeuchte eben nicht die Wassermenge das vorderste Problem sei. "Die Wassermenge in einem Raum wäre, je nach Material, überall unterschiedlich, die korrespondierende relative Luftfeuchte ist jedoch unabhängig vom Material."
Da KRL und CM zwei unterschiedliche Zustände (Wasserdampfdruck vs. Wassermenge) messen würden, könne man sie nicht direkt vergleichen. "Nicht die Estrichzuschläge sondern das Bindemittel Zement ist entscheidend. Im Bindemittel steckt die Feuchtigkeit und hier wird der Wasserdampfdruck entwickelt. Bei einer Reduzierung des Bindemittels ist weniger Wasser drin und der CM-Wert sinkt, doch der Dampfdruck bleibt erhalten."
Dr. Arnold rät: "Machen Sie bei beschleunigten Estrichen immer auch eine KRL-Messung, das ist sicherer." Und er hat dazu ein ganz aktuelles Argument: "Die KRL-Messmethode ist unter der DIN EN 17668 jetzt genormt. Den Grenzwert für die Belegreife beschreibt das TKB-Merkblatt 18." Für die CM-Methode gibt es in der Tat keine Norm. Sie bleibt zwar noch anerkannte Regel des Faches, doch die KRL-Messung als neuer Stand der Technik könnte ihr in Zukunft den Rang ablaufen.
| Henrik Stoldt
Thomas Allmendinger
Schwindverhalten von Estrichen
Verformungen und Spannungen bei Estrichen - mit diesem Thema zog der Sachverständige Thomas Allmendinger, selber Parkett- und Estrichleger, zuletzt auch durch Sachsen und Thüringen. "Randverformungen sind bei schwimmenden Estrichen nicht zu vermeiden",heißt es bereits im Kommentar zur DIN 18365. Der Prozess dauert während der Trocknung bis zur Ausgleichsfeuchte. In diesem Zuge sind Restverformungen bis 5 mm im Randbereich nicht zu beanstanden. Der Begriff Ausgleichsfeuchte darf jedoch nicht mit der Belegreife verwechselt werden. Zum Zeitpunkt seiner Montage, die mit der Belegreife beginnt, kann der Bodenleger die Restverformung nämlich nicht einschätzen. Was also tun? Den Auftraggeber darauf hinweisen, dass frühes Anbringen von Sockelleisten am Ende der Estrichverformung zu einer unerwünschten Fuge führen kann. Allmendiger: "Und entweder die Sockelleiste Monate später anbringen oder einen Viertelstab nachrüsten." Und wie lange dauert eine Estrich-Rückverformung? Allmendinger: "Nach der zweiten Heizperiode dürften keine Schäden durch Estrichprobleme mehr auftreten."
Ausschließlich Zementestriche sind es, die hier im Fokus stehen. "Es ist nur der Zementanteil, der Wasser binden kann", erklärt Allmendinger. Deshalb ist auch die Trocknungskurve beschleunigter Estriche keine außergewöhnliche. Sie starten allerdings schon am Anfang durch den Einsatz von Tensiden mit weniger Wasserbedarf. Das lässt sie früher trocken sein. Und die notwendige Feuchtemessung? Allmendiger: "Ich bin für eine CM-Messung im unteren Estrichdrittel, nicht im Querschnitt."
Da es neuerdings nach DIN EN 13892 auch Schwindklassen gibt, die der Planer festlegen muss, sollte sich der Bodenleger, außer der Feuchtemessung zur Belegreife, keine Verantwortung für den Untergrund zuziehen. "Über Ebenheitsmessungen sind Verformungen nicht erkennbar", betont Allmendinger. Und auch Biegezugfestigkeit und Winkeltoleranzen sind laut Allmendinger nicht Sache des Parkett- und Bodenlegers.
Nico Schattke
Fußbodenkühlung ist nicht geregelt
Die relative Luftfeuchte spielt auch eine Rolle, wenn es um Probleme an Holzböden gibt, die im Sommer von einer Fußbodenkühlung verursacht werden. In der Schnittstellenkoordination für Flächenheizungs- und -kühlungssysteme in bestehenden Gebäuden heißt es: Die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender Temperatur. Besonders an Kühlflächen, auf denen die Temperatur sehr niedrig ist, kann dieser (Tau-)Punkt relativ schnell erreicht werden. Als Folge dessen wird Schwitzwasser an diesen Flächen entstehen.
Parkett und Naturfaserböden sind solche Flächen. Dort sollte die relative Luftfeuchte durch entsprechende Regelmaßnahmen begrenzt werden. Doch im Gegensatz zur Heizfunktion, wo festgelegt ist, dass die Oberflächentemperatur am Holzboden auch in den Randzonen 29 °C nicht überschreiten darf, gibt es in Bezug auf Kühlung eben keine Regelung. Ein negatives Ergebnis beschreibt Nico Schattke: Nach einem Jahr hatte sich ein geöltes Mosaikparkett Eiche vom Untergrund gelöst. Der Grund: Je kühler die Luft, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Auf einem lackierten Boden würden sich Wassertropfen niederschlagen, in einen geölten Boden dringt die Feuchtigkeit sofort ein. Schattke: "Bei Erhöhung der Holzfeuchte um 4 % wird das Parkett um 1 % breiter. Ein Mosaikparkettwürfel mit 160 mm-Kantenlänge wird also 1,5 mm breiter. Das ist bei 1,6 m ein Wachstum von 1,5 cm." Diesem Quelldruck hält die Untergrundklebung nicht stand.
Und wer hat den "Schwarzen Peter"? "Prinzipiell ist der Planer verantwortlich", sagt Nico Schattke. "Fußbodenkühlung ist eine Sonderkonstruktion, die normativ nicht erfasst ist." Deshalb gibt er seinen Kollegen den Rat: "Beraten. Hinweise und Empfehlungen unterschreiben lassen!" Und wenn der Kunde es bezahlt, Temperatur- und Feuchtedatenlogger oder Sensoren mit einer Auslöseschwelle von 75 % rel. F. am Boden einbauen.
Joachim Barth
Große Dielen, große Probleme
Was ein Parkettstab und was eine Massivdiele ist - da überschneiden sich die DIN EN 13226 und die DIN EN 13269. Ein Parkettelement von 14 x 90 x 400 mm fällt nämlich in beide Kategorien. Wenn heute am Markt von Dielen die Rede ist, geht es aber meist um Längen über 2.000 mm. Präziser wird es beim Feuchtegehalt in der DIN EN 13619 "Massive Laubholzdielen und zusammengesetzte massive Laubholzdielen".
Die Verlegung langer Dielen setzt einen ebenen Untergrund voraus. "Da müssen wir eventuell mehr spachteln", betont der Sachverständige Joachim Barth. Sonst bleiben Hohlstellen. "Als Parkettleger schulden wir die Ebenheit der Dielenoberfläche." Und auch die Längskrümmung der Diele kann eine entscheidende Rolle spielen. "Nach DIN 13629 muss man bei der Bestellung langer Dielen angeben, ob sie geklebt werden sollen." Dann nämlich ist es nicht möglich, krumme Dielen, wie auf Holzbalkenlage, mit Gurtkraft in Stellung zu ziehen und zu fixieren. "Brettbreiten über 155 mm sind für eine verdeckte einseitige Befestigung nicht empfehlenswert", sagt der Kommentar zur DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten. Damit wäre die Klebung bei solchen Dielenbreiten aus dem Rennen. Sollen Dielen auf alte Weise geschraubt oder genagelt verlegt werden, dann empfiehlt Joachim Barth folgende Literatur: Das Schreinerbuch, Th. Krauth und F.J.Meyer,1899 sowie das Merkblatt I "Befestigung / Verlegung von massiven Dielen" von Parkett Hinterseer.
Ein anderer Punkt ist die Vorsortierung der Dielen - sowohl beim Lieferanten, wie auf der Baustelle. Barth: "Man muss den Endkunden darauf aufmerksam machen, dass eine Lieferung aus hellen und dunkleren Elementen besteht." Eine unpassende Diele sollte man auch einmal zur Seite stellen. Plakatbildung und ungewollte Farbunterschiede lassen sich dann vermeiden. Und auch bei falsch verkitteten Ästen kann ein Farbproblem auftreten. "Acrylverfugungen ändern im Laufe der Zeit ihren Farbton." aus Parkett Magazin 01/23 (Wirtschaft)
Kontroverse Themen und mahnende Worte
Zweimal im Jahr ruft die größte deutsche Innung der Parkett- und Bodenleger ihre Mitglieder zusammen. Rund 160 Teilnehmer kamen zur Herbstversammlung nach Weimar. Das zeitlich entspannte Programm bot an zwei Tagen Fachvorträge, Ehrungen und Workshops - sowie eine imposante Ausstellung mit 37 Herstellern und Lieferanten.Nach zwei Jahren mit übervollen Auftragsbüchern ist die noch im Frühjahr herrschende Zuversicht gesunken. "Bauherren ziehen wegen steigender Preise und Zinsen ihre Aufträge zurück", beschrieb Holger Wiehle, Obermeister der Innung Nordost Parkett und Fußbodentechnik, auf der Mitgliederversammlung in Weimar die veränderte Lage. Bundesweit sei bereits ein Rückgang von 12 % zu verzeichnen. Angst breite sich aus, Sprache und Umgang würden rauer. "Aber wir Handwerker im Osten sind Krisen und Kummer gewohnt und können improvisieren", lautet seine positive Botschaft an die Kollegen.
Mit 140 Voll- und 69 Fördermitgliedern geht die Innung Nordost ins Jahr 2023. Material- und Lieferschwierigkeiten werden den Weg begleiten. Holger Wiehle erkennt aber an, "dass die Industrie die Qualität ihrer Produkte auch hinsichtlich der Zuschlagsstoffe halten will". Auch die vielen Weiterbildungsangebote direkt von Herstellern hält er für eine gute Idee, möchte Themen, die den Handwerker umtreiben, aber gemeinsam mit den Fördermitgliedern abstimmen.
Mahnende Worte zur Ausbildung
und viele Ehrungen
Wenig Antrieb attestierte Lehrlingswart Rico Zellhuber einer Reihe von Auszubildenden im zweiten Lehrjahr an der Berufsschule Plauen, weil in der jüngsten Zwischenprüfung fünf in der Praxis und fünf in der Theorie durchgefallen sind. Ein Lichtblick dagegen Franz Dybeck, der mit seinem Gesellenstück die volle Punktzahl von 100 abräumte und als Landessieger Parkett zusammen mit dem Landessieger Bodenleger, Konrad Vogel aus Berlin, geehrt wurde. Damit nicht genug der Ehrungen: Plaketten erhielten die beiden frisch gebackenen Meister Sven Hausdorf und Robert Blank, eine Urkunde für aktive 45 Jahre bekam Gerd Zellhuber und der ehemalige Bundesinnungsmeister Joachim Barth wurde, wenn auch zwei Jahre verspätet, mit dem goldenen, 50-jährigen Meisterbrief ausgezeichnet.
Sie sind Vorbild für Leute, die es in der Branche nach oben schaffen wollen. Dass zum Meisterkurs am 30. August ursprünglich 24 Gesellen Interesse bekundet hatten, dann 19 erschienen und zu Beginn der Fortbildung noch 13 übrig waren, stimmt allerdings nachdenklich. Aus Berlin hatte Robert Mutschall keine besseren Nachrichten. Die Gesellenstücke von vier Absolventen der Max-Bill-Schule seien eher anspruchslos. "Fehlende Motivation ist der Knackpunkt." Die Kritik abzumildern versuchte Peter Palme, Schulleiter am Bildungszentrum Plauen: "Wir haben keine anderen Jugendlichen und müssen es gemeinsam schaffen. Da braucht es auch soziale Kompetenz."
Achtung vor Liefermaterial
ohne CE-Kennzeichen
Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass ein Produkt den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft entspricht. Wer ein Produkt oder Material nach Europa einführt, muss dieses gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichen erwerben und nachweisen. Bei Holz ist das, wie Holger Wiehle erfuhr, nicht immer der Fall. Da hatte ein Generalunternehmer Parkett direkt auf die Baustelle liefern und vom Handwerker verlegen lassen. Als von Kundenseite die Abnahme erfolgen sollte, wurde penibel nach Fehlern gesucht. An der Verlegung gab es nichts auszusetzen, doch der kritische Blick in die Lieferpapiere des Materials fand keine CE-Kennzeichnung.
Was nun? Fakt war: Die zugesagte Eigenschaft der europäischen Zulassung war nicht eingehalten worden. Der Generalunternehmer wandte sich an seinen Lieferanten, der wiederum an den ausländischen Hersteller - und von dort kam eine sogenannte Declaration of Performance (DoP). Zwar ist die DoP-Leistungserklärung tatsächlich ein Baustein für eine CE-Kennzeichnung, bedauerlicherweise war in diesem Fall das Dokument aber knapp zehn Jahre alt und entsprach nicht mehr den aktuellen Brandschutzanforderungen. Das Ende vom Lied: Der Kunde akzeptierte diese DoP nicht, hatte aber auch kein Interesse, den gut verlegten Boden wieder herausreißen zu lassen. Ihm ging es lediglich darum, den Preis zu drücken oder gar nicht zu bezahlen.
Hätte der Parkettleger sein Material auf CE-Kennzeichnung prüfen müssen? In diesem Fall lag die Verantwortung beim Generalunternehmer. Doch bei einem Privatkunden sollte der Handwerker die europäische Konformität seines gelieferten Holzbodens selber prüfen. Normalerweise steht das CE-Zeichen auf der Verpackung. Im Zweifelsfall kann die Zulassung des Produktes beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erfragt werden. Fehlen alle Informationen, gilt es, beim Auftraggeber Bedenken geltend zu machen.
KRL-Messmethode hat jetzt eine Norm
Wenn es Zweifel an der Belegreife gibt, immer Bedenken anmelden. Vom Estrichleger kann der Parkett- und Bodenleger keine Freigabe erhalten, weder mündlich noch schriftlich. Dr. Norbert Arnold (Uzin): "Nur der, der die Rechnung zahlt, also der Vertragspartner, kann sich über Bedenken hinweg setzen und eine Freigabe erteilen."
Es sind die zementarmen, mageren Estriche, die - so prognostiziert Dr. Arnold - in Zukunft für mehr Unsicherheit hinsichtlich der Belegreife sorgen werden. Zur Messung gerade dieser Untergründe sei die KRL-Methode der CM-Messung überlegen. Warum? Weil das Wasser allein im Zement stecke, in einer 50g-Probe zur CM-Messung aber nur rund 7 g-Zement enthalten seien. Der Rest ist Sand. Gemessen wird hier also die Wassermenge anhand einer fragwürdigen Probe. Zudem, so Dr. Arnold, sei die Wassermenge das Geringste von drei Estrichkriterien, die zu Feuchtschäden führen können. Am wichtigsten sei eine offene, also wasserdurchlässige Oberfläche, an zweiter Stelle stehe der Wasserdampfdruck. Denn dieser Druck bewirke, dass Feuchtigkeit nach oben strebe. Und genau das misst die korrespondierende relative Luftfeuchte.
Warum die Überlegenheit der KRL-Methode gegenüber CM für viele schwer zu verstehen sei, erklärt Dr.Arnold anhand eines Klimavergleiches. Das Wüstenklima bei 40 °C und 20 % rLf wirke gegenüber einem 5 °C nasskalten Schmuddelwetter mit 80 % rel. F. zwar trockener, tatsächlich aber habe die Wassermenge in der Wüstenluft mehr Feuchtigkeit angereichert, als das ungemütliche Herbstwetter. Erst, wer das begreife, könne erkennen, dass bei der Estrichfeuchte eben nicht die Wassermenge das vorderste Problem sei. "Die Wassermenge in einem Raum wäre, je nach Material, überall unterschiedlich, die korrespondierende relative Luftfeuchte ist jedoch unabhängig vom Material."
Da KRL und CM zwei unterschiedliche Zustände (Wasserdampfdruck vs. Wassermenge) messen würden, könne man sie nicht direkt vergleichen. "Nicht die Estrichzuschläge sondern das Bindemittel Zement ist entscheidend. Im Bindemittel steckt die Feuchtigkeit und hier wird der Wasserdampfdruck entwickelt. Bei einer Reduzierung des Bindemittels ist weniger Wasser drin und der CM-Wert sinkt, doch der Dampfdruck bleibt erhalten."
Dr. Arnold rät: "Machen Sie bei beschleunigten Estrichen immer auch eine KRL-Messung, das ist sicherer." Und er hat dazu ein ganz aktuelles Argument: "Die KRL-Messmethode ist unter der DIN EN 17668 jetzt genormt. Den Grenzwert für die Belegreife beschreibt das TKB-Merkblatt 18." Für die CM-Methode gibt es in der Tat keine Norm. Sie bleibt zwar noch anerkannte Regel des Faches, doch die KRL-Messung als neuer Stand der Technik könnte ihr in Zukunft den Rang ablaufen.
| Henrik Stoldt
Thomas Allmendinger
Schwindverhalten von Estrichen
Verformungen und Spannungen bei Estrichen - mit diesem Thema zog der Sachverständige Thomas Allmendinger, selber Parkett- und Estrichleger, zuletzt auch durch Sachsen und Thüringen. "Randverformungen sind bei schwimmenden Estrichen nicht zu vermeiden",heißt es bereits im Kommentar zur DIN 18365. Der Prozess dauert während der Trocknung bis zur Ausgleichsfeuchte. In diesem Zuge sind Restverformungen bis 5 mm im Randbereich nicht zu beanstanden. Der Begriff Ausgleichsfeuchte darf jedoch nicht mit der Belegreife verwechselt werden. Zum Zeitpunkt seiner Montage, die mit der Belegreife beginnt, kann der Bodenleger die Restverformung nämlich nicht einschätzen. Was also tun? Den Auftraggeber darauf hinweisen, dass frühes Anbringen von Sockelleisten am Ende der Estrichverformung zu einer unerwünschten Fuge führen kann. Allmendiger: "Und entweder die Sockelleiste Monate später anbringen oder einen Viertelstab nachrüsten." Und wie lange dauert eine Estrich-Rückverformung? Allmendinger: "Nach der zweiten Heizperiode dürften keine Schäden durch Estrichprobleme mehr auftreten."
Ausschließlich Zementestriche sind es, die hier im Fokus stehen. "Es ist nur der Zementanteil, der Wasser binden kann", erklärt Allmendinger. Deshalb ist auch die Trocknungskurve beschleunigter Estriche keine außergewöhnliche. Sie starten allerdings schon am Anfang durch den Einsatz von Tensiden mit weniger Wasserbedarf. Das lässt sie früher trocken sein. Und die notwendige Feuchtemessung? Allmendiger: "Ich bin für eine CM-Messung im unteren Estrichdrittel, nicht im Querschnitt."
Da es neuerdings nach DIN EN 13892 auch Schwindklassen gibt, die der Planer festlegen muss, sollte sich der Bodenleger, außer der Feuchtemessung zur Belegreife, keine Verantwortung für den Untergrund zuziehen. "Über Ebenheitsmessungen sind Verformungen nicht erkennbar", betont Allmendinger. Und auch Biegezugfestigkeit und Winkeltoleranzen sind laut Allmendinger nicht Sache des Parkett- und Bodenlegers.
Nico Schattke
Fußbodenkühlung ist nicht geregelt
Die relative Luftfeuchte spielt auch eine Rolle, wenn es um Probleme an Holzböden gibt, die im Sommer von einer Fußbodenkühlung verursacht werden. In der Schnittstellenkoordination für Flächenheizungs- und -kühlungssysteme in bestehenden Gebäuden heißt es: Die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender Temperatur. Besonders an Kühlflächen, auf denen die Temperatur sehr niedrig ist, kann dieser (Tau-)Punkt relativ schnell erreicht werden. Als Folge dessen wird Schwitzwasser an diesen Flächen entstehen.
Parkett und Naturfaserböden sind solche Flächen. Dort sollte die relative Luftfeuchte durch entsprechende Regelmaßnahmen begrenzt werden. Doch im Gegensatz zur Heizfunktion, wo festgelegt ist, dass die Oberflächentemperatur am Holzboden auch in den Randzonen 29 °C nicht überschreiten darf, gibt es in Bezug auf Kühlung eben keine Regelung. Ein negatives Ergebnis beschreibt Nico Schattke: Nach einem Jahr hatte sich ein geöltes Mosaikparkett Eiche vom Untergrund gelöst. Der Grund: Je kühler die Luft, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Auf einem lackierten Boden würden sich Wassertropfen niederschlagen, in einen geölten Boden dringt die Feuchtigkeit sofort ein. Schattke: "Bei Erhöhung der Holzfeuchte um 4 % wird das Parkett um 1 % breiter. Ein Mosaikparkettwürfel mit 160 mm-Kantenlänge wird also 1,5 mm breiter. Das ist bei 1,6 m ein Wachstum von 1,5 cm." Diesem Quelldruck hält die Untergrundklebung nicht stand.
Und wer hat den "Schwarzen Peter"? "Prinzipiell ist der Planer verantwortlich", sagt Nico Schattke. "Fußbodenkühlung ist eine Sonderkonstruktion, die normativ nicht erfasst ist." Deshalb gibt er seinen Kollegen den Rat: "Beraten. Hinweise und Empfehlungen unterschreiben lassen!" Und wenn der Kunde es bezahlt, Temperatur- und Feuchtedatenlogger oder Sensoren mit einer Auslöseschwelle von 75 % rel. F. am Boden einbauen.
Joachim Barth
Große Dielen, große Probleme
Was ein Parkettstab und was eine Massivdiele ist - da überschneiden sich die DIN EN 13226 und die DIN EN 13269. Ein Parkettelement von 14 x 90 x 400 mm fällt nämlich in beide Kategorien. Wenn heute am Markt von Dielen die Rede ist, geht es aber meist um Längen über 2.000 mm. Präziser wird es beim Feuchtegehalt in der DIN EN 13619 "Massive Laubholzdielen und zusammengesetzte massive Laubholzdielen".
Die Verlegung langer Dielen setzt einen ebenen Untergrund voraus. "Da müssen wir eventuell mehr spachteln", betont der Sachverständige Joachim Barth. Sonst bleiben Hohlstellen. "Als Parkettleger schulden wir die Ebenheit der Dielenoberfläche." Und auch die Längskrümmung der Diele kann eine entscheidende Rolle spielen. "Nach DIN 13629 muss man bei der Bestellung langer Dielen angeben, ob sie geklebt werden sollen." Dann nämlich ist es nicht möglich, krumme Dielen, wie auf Holzbalkenlage, mit Gurtkraft in Stellung zu ziehen und zu fixieren. "Brettbreiten über 155 mm sind für eine verdeckte einseitige Befestigung nicht empfehlenswert", sagt der Kommentar zur DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten. Damit wäre die Klebung bei solchen Dielenbreiten aus dem Rennen. Sollen Dielen auf alte Weise geschraubt oder genagelt verlegt werden, dann empfiehlt Joachim Barth folgende Literatur: Das Schreinerbuch, Th. Krauth und F.J.Meyer,1899 sowie das Merkblatt I "Befestigung / Verlegung von massiven Dielen" von Parkett Hinterseer.
Ein anderer Punkt ist die Vorsortierung der Dielen - sowohl beim Lieferanten, wie auf der Baustelle. Barth: "Man muss den Endkunden darauf aufmerksam machen, dass eine Lieferung aus hellen und dunkleren Elementen besteht." Eine unpassende Diele sollte man auch einmal zur Seite stellen. Plakatbildung und ungewollte Farbunterschiede lassen sich dann vermeiden. Und auch bei falsch verkitteten Ästen kann ein Farbproblem auftreten. "Acrylverfugungen ändern im Laufe der Zeit ihren Farbton." aus Parkett Magazin 01/23 (Wirtschaft)
