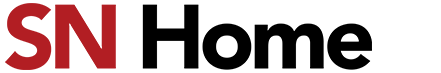
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
22. Internationales Sachverständigentreffen, Schweinfurt
Schon traditionell führte Simon Thanner, Obmann des BEB-Arbeitskreises Sachverständige, als Moderator durch die zweitägige Veranstaltung im Schweinfurter Mercure-Hotel. Er richtete die Grüße des BEB-Vorsitzenden Michael Schlag aus, der kürzlich Vater geworden ist und deshalb nicht teilnehmen konnte. Simon Thanner berichtete in seiner Einführung, dass die sogenannte Rückvermeisterung des Estrichlegerhandwerks in absehbarer Zeit auf den Prüfstand kommen werde. Im Mittelpunkt stehe dabei zum einen die Gefahrgeneigtheit des Handwerks, zum anderen aber auch die Zahlen der Estrichlegermeister und der Estrichleger-Auszubildenden: "Die Zahl der Meister im Estrichlegerhandwerk steigt zwar, aber es gibt gar nicht mehr zusätzliche Plätze in den Meisterkursen. Bei den Lehrlingen flacht die Kurve der Estrichleger gerade ab", berichtete Thanner, der sich für Rückvermeisterung des Estrichlegerhandwerks im Jahr 2020 stark engagiert hatte und schließlich erfolgreich war. Thanner warb dafür, dass die Meisterpflicht im Estrichlegerhandwerk nicht automatisch für die Zukunft sicher sei, weil verschiedene politische Parteien das Thema unterschiedlich bewerten würden.
Was kaum ein Teilnehmer ahnte, sei als kleine Anekdote am Rande gestattet: Den viel beschriebenen Fachkräftemangel im Handwerk gab es ganz konkret auch am Tagungsort bei den Hotel-Mitarbeitern. So standen kurzerhand hinter dem Bar-Thresen ein leitender Hotel-Manager, sein Stellvertreter und ein Koch des Hotels, um die Sachverständigen wie gewohnt mit Getränken versorgen zu können. Sie alle, wie auch die Mitarbeiter des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, trugen zum Erfolg des 22. Internationalen Sachverständigentreffens bei, bei dem erstmals die Rekord-Marke von 300 Teilnehmern überschritten wurde.
FussbodenTechnik fasst die elf Fachvorträge zusammen:
Dr. David Reindl, Dr. Schutz
Oberflächenbeschichtung von Sichtestrichen und -spachtelmassen
Sichtspachtelböden erfreuen sich durch ihren industriellen Betonboden-Look zunehmender Beliebtheit. "Jeder dieser Böden ist ein Unikat", erklärte Dr. David Reindl, Leiter Entwicklung und Anwendungstechnik beim Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Dr. Schutz. Damit die mineralischen Böden auch hinsichtlich der Schmutzempfindlichkeit und des Reinigungsverhaltens dauerhaft attraktiv bleiben, empfiehlt sich eine schützende Versiegelung - also eine Beschichtung mit einem transparenten Lacksystem. Der Referent verglich die mineralischen Böden mit Holzbelägen, bei denen es sich ebenfalls um saugende Untergründe handelt. "Man muss die Saugfähigkeit sättigen oder blockieren, damit Flüssigkeiten nicht zu Farbveränderungen oder gar zu Abnutzungen führen", empfahl Dr. Reindl. Im Gegensatz zu Holz gibt es bei mineralischen Oberflächen keine Vorzugsrichtung des Auftrags aufgrund des Holzwuchses. Dafür kann allerdings die handwerkliche Applikation eine Uneinheitlichkeit des Auftrags verursachen: Denkbar sind optische Auffälligkeiten wie Rollenspuren und Überlappungsmarkierungen. Dr. Reindls Tipp: "Den mineralischen Untergrund für eine Versiegelung nicht zu fein schleifen." Eine Grundierung sollte grundsätzlich satt aufgetragen werden, um Rollenspuren zu verhindern und ein einheitliches optisches Bild zu erzeugen.
Eine Spachtelmasse sollte vom Spachtelmassenhersteller als ausgewiesen zur Erstellung von Sichtspachtelböden sein. Da der Spachtelboden die boden-
üblichen mechanischen und chemischen Belastungen aufnehmen muss, sind gemäß den Erfahrungen von Dr. Reindl im wesentlichen zementgebundene Spachtelmassen geeignet.
Eine aktuelle Liste der freigegebenen Spachtelmassen finden Interessierte auf der Webseite von Dr. Schutz. Insbesondere wichtig bei den Freigabeprüfungen ist die Haftung des Siegels am Untergrund, ohne die wichtige Funktionen der Oberfläche eingeschränkt werden.
Ralf Winter, Leiter Qualitätsmanagement bei Findeisen
Maßänderung bei Nadelvlies-Bodenbelägen
Ralf Winter, Leiter Qualitätsmanagement bei Findeisen, thematisierte Maßänderungen bei Bodenbelägen. Diese stellen grundsätzlich eine unvermeidbare, physikalische Gesetzmäßigkeit dar. Im Bezug auf Nadelvlies-Bodenbeläge kann die Höhe der Maßänderung durch die Konstruktion und die Wasseraufnahme der gewählten Polyamidfasern beeinflusst werden. Der Einsatz von "Standard-Polyamidfasern" - dazu zählen insbesondere Polyamid 6 und Polyamid 6.6 - bedingt höhere und nach den Regeln des Fachs zulässige Maßänderungen und macht eine feste Verklebung des Nadelvlies-
Bodenbelags mit geeigneten Klebstoffen erforderlich.
Durch den Einsatz anderer Polyamide ist eine Reduzierung der normativ zulässigen Maßänderung von max. 1,2 % (Bahnenware) auf max. 0,2 % möglich, sodass eine wiederaufnehmbare Verlegung (in Modulform, aber auch als Bahnenware ) möglich ist.
Bei Modulen nimmt das Polyamid deutlich weniger Wasser auf. Allerdings kann aus wirtschaftlichen Gründen auf die Verwendung von Standard-Polyamidfasern aktuell noch nicht verzichtet werden. Als alternative Polyamid-Beispiele nannte Winter PA 6.10, PA 6.12, PA 10.10, PA 11 und PA 12, die sich durch den unterschiedlichen Aufbau des eingesetzten Polymers auszeichnen. Standard-Polyamidfasern zeigten bei Vergleichstest in Form von Stuhlrollenprüfungen deutliche Vorteile z. B. gegenüber Polypropylen-Fasern, weil Polyamid deutlich geringere Aufhellungen zeigte, wie der Referent erläuterte.
Winter wies darauf hin, dass die die in der Norm DIN EN 1307 "Textile Beläge" genannten Parameter von mit einem Schrumpfungswert von 1,2 % (entspricht 12 mm pro m) und einem Ausdehnungswert von 0,5 % (5 mm pro m) nur für lose verlegte Bodenbeläge gilt, hingegen nicht für fest verklebte Bahnenware.
Ernst Weinzierl, ö.b.u.v. Sachverständiger
Problem LVT-Klickverbindungen
Der Sachverständige Ernst Weinzierl sensibilisierte für die Problematik von mangelhaften LVT-Klickverbindungen aus asiatischen Ländern, wobei er dabei explizit auf minderwertige Ware abstellte. Der großen Marktbedeutung der LVT-Klickbeläge stehe manchmal wenig Materialkenntnis bei Verkäufern und Verlegern gegenüber. Als Beispiel nannte Weinzierl die Berufsgruppe der Schreiner. Hinzu kämen Beratungsfehler, wenn extrem schwere Möbel (wie Öfen oder Küchenmöbel) auf die Klickbeläge gestellt werden, für deren Belastung sie gar nicht freigegeben wären. Den Verlegern empfahl Weinzierl dringend, die Verlegeanleitungen zu lesen, da manche Hersteller höhere Anforderungen stellen als die in Normen genannten. Er zitierte eine Reihe von Beispielen: So gibt es Hersteller, die fordern, den Belag 48 Stunden in den zu verlegenden Räumen oder in angrenzenden Räumen zu lagern. Deshalb reiche es nicht nicht aus, einen Lagerraum mit identischen klimatischen Bedingen zu wählen, weil der Verleger so den Herstellervorgaben nicht nachkomme (auch wenn er dies als fragwürdig empfand).
Ein anderes Beispiel sei die Begrenzung der Warmwassertemperatur einer Fußbodenheizung: Bodenbelagshersteller nennen durchaus 29 °C als erlaubte Grenze der Oberflächentemperatur. Der Verband MMFA hingegen benennt eine Kontakttemperatur von 27 °C - im Schadensfall können auch kleine Unterschiede den Ausschlag geben. Problematisch findet Weinzierl, dass sämtliche LVT-Beläge in der Regel die Anforderungen der Produktnorm DIN EN ISO 10582 bestehen. In der späteren Diskussion ergänzte der Sachverständige Torsten Grotjohann, dass Klickverbindungen durchaus bereits nach zwei Jahren Alterungserscheinungen aufweisen und brechen. Der Sachverständige Rainer Düßmann, der zahlreiche Klick-LVT-Schadensfälle begleitete, sieht die Temperaturschwankungen auf dem Transportweg als problematisch an: "In Südostasien kann sich ein Transport-Container durchaus auf 60 °C aufheizen und wird später im Winter bei uns bei 0 °C angeliefert." So könne es zu Vorschäden in den Belägen kommen. Nur mit Hilfe von labortechnischen Untersuchungen können man eventuellen Vorschäden sicher auf den Grund gehen.
Ernst Weinzierl appellierte abschließend an Baumärkte und den Großhandel, Klick-LVT aus zweifelhaften Quellen vor dem Inverkehrbringen zu überprüfen, um existentielle Schäden beim Verleger auszuschließen.
Prof. Dr. Christoph Müller, Geschäftsführer VDZ Technology
So gelingt die Dekarbonisierung von Zement und Beton in der Praxis
Wie kann es gelingen, den Kohlenstoffdioxidausstoß der deutschen Zementindustrie weiter zu senken? Und ist es möglich, in den nächsten 30 Jahren
klimaneutrale Herstellungsprozesse zu erreichen? Das waren Fragen, mit denen sich der Referent Prof. Dr. Christoph Müller, Geschäftsführer VDZ Technology, beschäftigte. Die Zementindustrie hat als starker Verursacher von CO bei der Herstellung ihrer Produkte ambitionierte Ziele, den Kohelnstoffdioxid- ausstoß zu minimieren. Prof. Dr. Müller stellte in diesem Zusammenhang die Publikation "Dekarbonisierung von Zement und Beton - Minderungspfade und Handlungsstrategien" vor. Diese zeigt auf, inwieweit der CO-Ausstoß der Branche in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits gesenkt wurde, wo die Stellschrauben für eine weitere Reduzierung zu finden sind und welche gesamtgesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen zu bewältigen wären, um eine Klimaneutralität des Baustoffs zu erreichen.
Die Verwendung klinkereffizienter Zemente ist ein wichtiger Baustein bei der Dekarbonisierung von Zement und Beton. Im Hochbau können über klinkereffiziente Zemente wie z. B. CEM II/C in der Herstellung des Betons kurzfristig etwa 20 % CO eingespart werden. Das Regelwerk für Beton muss noch konsequenter als bisher die Ziele Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz unterstützen. Hierzu zählt die differenzierte Verwendung klinkereffizienter Zemente, die auch im Estrich zum Einsatz kommen.
Egbert Müller, Leiter Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF)
IBF-Forschungsergebnisse zu klinkereffizienten Zementen
Egbert Müller, Leiter des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF), stellte die Ergebnisse einer Untersuchung beim Einsatz von klinkereffizienten Zementen bei Estrichen vor. Diese wurde in Auftrag gegeben von den Zementherstellern Dyckerhoff, Schwenk Zement, Heidelberg Materials, Cemex und Holcim und mit Mitteln aus dem Forschungsetat des BEB gefördert. Grob gesagt untersuchte das IBF die Frischmörteleigenschaften, die Festigkeiten an Prismen, die Oberflächen- und Biegezugfestigkeit, das Schwind- und Austrocknungsverhalten sowie das Verformungsverhalten von Estrichen - mit und ohne klinkereffizienten Zementen. Folgende Aussagen konnten unter anderem getroffen werden: Die CM-Messung war bei allen geprüften mit klinkereffizienten Zementen hergestellten Zementestrichen uneingeschränkt möglich. Bei allen so hergestellten Zementestrichen kann der Belegreifgrenzwert 2 CM-% für unbeheizte Zementestriche angewendet werden. Bei einigen Zementestrichen sei allerdings mit einer längeren Austrocknungszeit zum Erreichen des Belegreifgrenzwerts 2 CM-% zu rechnen.
Georg Kuntner, Technischer Leiter e4 Bauchemie
Neue Zemente in Verbindung mit Estrichzusatzmitteln
"Neue klinkereffiziente Zemente können durchaus für Estriche eingesetzt werden", sagte Georg Kuntner, Technischer Leiter von e4 Bauchemie. Aus heutiger Sicht seien nicht alle der neuen Zemente zur Estrichherstellung sinnvoll. Hierzu sollten sich nach Ansicht des Sachverständigen Georg Kuntner auch die Zementhersteller Gedanken machen. Durch die höhere Anzahl an Zementen, vor allem CEM II/B- und CEM III-Zemente, wird die Variabilität deutlich größer. "Dies wird zur Folge haben, dass es sehr viel wichtiger wird, sich mit den einzelnen Komponenten des Estrichs auseinanderzusetzen", ist Kuntner überzeugt.
Da jedoch die Vielzahl an möglichen Einflüssen wie z. B. Sandqualität, Verarbeitung, Raumklima usw. einfließen, wird es für den Estrichhersteller immer anspruchsvoller, die vereinbarte Qualität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von geeigneten Zusatzmitteln könne in vielfacher Hinsicht positiv dazu beigetragen werden, jedoch könne kein Zusatzmittel "zaubern". Die größte Herausforderung für überregional verarbeitende Estrichfachbetriebe wird die Beschaffung bekannter Rohstoffe bzw. des "richtigen Zements" in Verbindung mit dem passenden Estrichsand und Zusatzmitteln werden, so der Referent abschließend.
Thomas Brendel, Chemotechnik Abstatt
Was muss der Estrichleger bei neuen Zementen beachten?
Der ö.b.u.v. Sachverständige für Estrich und Industrieböden, Thomas Brendel, Estrichlegermeister und Betontechnologe in Diensten von Chemotechnik Abstatt, beschäftigte sich mit der Frage, was der Estrichleger bei den neuen klinkereffizienten Zementen beachten muss.
Brendel erläuterte, dass sich die mit reduzierten Klinkergehalten und latent hydraulischen (= reaktiv) oder inerten (= nicht reaktiv) Bestandteilen hergestellten CEM II- und CEM III-Zemente in ihren Eigenschaften von bisherigen CEM I-Zementen unterscheiden. Die Auswahl an CEM II-Zementen ist groß: CEM II ist nicht CEM II. Je nachdem, welche Hauptbestandteile in den Zementzubereitungen enthalten sind und in welchen Anteilen, sind unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten.
Auch wenn Normprüfungen im Labor keine großen Unterschiede erkennen lassen, mahnt Brendel zur Vorsicht, Ergebnisse unter Laborbedingungen seien nicht auf die Baustelle übertragbar. Es ist zu erwarten, dass die bei Estrichen im Baustellenalltag häufig frühzeitige Austrocknung bei Estrichen aus klinkerreduzierten CEM II- und CEM III-Zementen zu vermehrten Problemen mit mangelnden Oberflächenfestigkeiten führen wird. Auch ist zu befürchten, dass die feinere Mahlung des Klinkers und die Verwendung von Hüttensand das Schwindverhalten der Estriche nachteilig beeinflusst.
Brendel wies darauf hin, dass die neuen Zemente sensibler auf kritische Baustellenbedingungen und Veränderungen der Rezeptur reagieren werden. Der Estrichhersteller muss deshalb für seinen Baustelllenestrich diejenigen Zemente und Zusatzmittel auswählen, die zum Erreichen der jeweiligen Anforderungen geeignet sind und er muss seiner in der Erstprüfung festgelegten Rezeptur treu bleiben.
Die Thematik ist nicht neu. Sie ernst zu nehmen wird mit der Umstellung auf CEM II- und CEM III-Zemente aber wichtiger denn je, wenn der Estrichleger keine unliebsamen Überraschungen erleben will.
Eine ausführliche Zusammenfassung des Referats finden Sie ab Seite 108.
Katharina Bleutge, Rechtsanwältin
Update JVEG - Neues zum Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
Die Justiziarin am Institut für Sachverständigenwesen in Köln, Katharina Bleutge, informierte die Sachverständigen über das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (abgekürzt JVEG). Dieses ist in Deutschland mit Wirkung vom 1. Juli 2004 an die Stelle des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZuSEG) und des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter getreten. Die Referentin informierte bei ihrem dritten Auftritt in Schweinfurt, wie die Sachverständigen ihre Honorarforderungen durchsetzen.
Die Sachverständigen werden nicht mehr nach Honorargruppen vergütet, sondern der Stundensatz richtet sich nach Feststundensätzen, die 39 Sachgebieten zugeordnet sind. Die Stundensätze liegen durchschnittlich zwischen 70 und 155 EUR. Die Zuordnung erfolgt nicht nach dem Bestellungstenor, sondern nach dem Inhalt des Beweisbeschlusses. Als Besonderheiten nannte Bleutge Gutachten, die mehrere Bereiche betreffen: Hier erfolgt die Berechnung nach dem höchsten Stundensatz. Für jede Stunde an Sonn- und Feiertagen oder zur Nachzeit gibt es einen Zuschlag in Höhe von 20 %.
Christian Hoppe, Ingenieurbüro Hoppe Akustik
Harter Boden - wohliges Raumgefühl dank Raumakustik
Christian Hoppe stellte die Grundlagen der Bau- und Raumakustik und deren Wirkung auf den Menschen vor. Entscheidend für eine angenehme Raumakustik ist dabei die Nachhallzeit, d. h. die Zeit die vergeht, bis der Schallpegel um 60 dB abgenommen hat. In einem üblichen Büroraum soll diese bei 0,5 bis 0,8 Sekunden liegen, in einem größeren Konferenzraum bei 0,8 bis 1,2 Sekunden und in Kirchen kann diese 4 bis 6 Sekunden erreichen. Ziel ist es, eine möglichst kurze Nachhallzeit zu erreichen, um die Lärmspirale aus schlechter Akustik, lauterer Unterhaltung und dadurch noch schlechterer Akustik zu vermeiden. Dazu stellte er zwei innovative Lösungen vor: Der Ringabsorber ist ein nur ca. 30 cm breites Band aus schallabsorbierendem Recycling-Material, das in den Deckenecken des Raums installiert wird. In den Deckenecken wird der Schall reflektiert und dann absorbiert. Somit kann mit relativ geringem konstruktivem Aufwand eine optisch ansprechende und schnell einzubauende Lösung für eine günstige Raumakustik verwirklicht werden.
Beim Streifenabsorber werden streifenförmige Absorber aus Recyclingglas in die Betondecke integriert. Die Schallreduktion erfolgt dabei zum einen durch das Absorbermaterial und darüber hinaus sehr wirksam auch über die Beton-Absorber-Kanten. Auch hier wird mit geringem Aufwand eine erhebliche Verbesserung der Raumakustik erreicht. Trotz harter Böden und Decken resultiert am Ende ein gutes Raumgefühl, was sich positiv auf die Aufenthaltsqualität und die Leistungsfähigkeit der Nutzer auswirkt.
Arnd Pferdehirt, Lanxess & Andreas Paul, Karl Bachl
Leichtausgleich - gewusst wie
Die Erderwärmung durch CO ist ein Thema, das uns alle betrifft. Zu dessen Reduktion kann der wärmedämmende Leichtausgleich mit expandiertem Polystyrol (EPS) seinen Beitrag leisten. Für Neumaterial wird dabei das Polystyrolgranulat mit Wasserdampf expandiert und in Form gebracht. Auch Recycling- material ist für die Verwendung im Leichtausgleich einsetzbar. Wichtig ist dabei eine effektive Eingangskontrolle des Recyclats, damit z. B. die Rückführung von als kritisch angesehenen Brandschutzmitteln in den Materialkreislauf verhindert wird. Seine volle Leistungsfähigkeit als Leichtausgleich aus EPS und Zement erreicht dieser erst durch Einsatz von speziellen Additiven, wie z. B. Antistatika zur Behandlung der Polystyrolkügelchen. Dadurch lassen sich die technischen Eigenschaften erheblich verbessern: Absetzen des Zements wird verhindert, die Druckfestigkeit wird erhöht und der W/Z-Wert erniedrigt, was zu kürzeren Trocknungszeiten führt. Der Restfeuchtegehalt des Leichtausgleichs kann über die CM-Messung ermittelt werden, wobei die zulässigen Restfeuchtewerte materialspezifisch vom Hersteller vorgegeben werden. Die Einsatzbedingungen für die Leichtausgleichsschichten werden über die einschlägigen Regelwerke DIN 18560-2, DIN 4108-10 sowie das BEB Hinweisblatt 4.6 vorgegeben.
Frank Seifert, Baustoffingenieur, seit November 2022 e4 Bauchemie
Was das KRL-Verfahren wirklich misst
Frank Seifert stellte vor, wie korrespondierende relative Luftfeuchten (KRL) über die Ermittlung der Sorptionsisothermen nach ISO/DIS 12571 mit den jeweiligen Feuchtegehalten zusammenhängen. Bei der KRL-Methode nach DIN EN 17668 wird die Feuchteaktivität als äquivalenter Wert des freibeweglichen Wassers im Prüfgut als KRL angesehen. Diese entspricht der relativen Luftfeuchte über der gesättigten Lösung des Porenwassers in der Probe. Diese relative Gleichgewichtsfeuchte wird auch als Deliqueszenzfeuchte (DRH) bezeichnet. "Der absolute Feuchtegehalt der Probe kann daraus nicht unmittelbar abgeleitet werden", so der Referent. Die über die KRL-Methode gemessene relative Luftfeuchte entspreche also der charakteristischen DRH der Porenflüssigkeit. Diese wiederum werde von den in der Porenflüssigkeit vorhandenen Salzen bestimmt. Hierzu wurde von Frank Seifert auch der Einfluss des Zusatzes unterschiedlicher Salze zu den Estrichmörtelrezepturen untersucht. Durch das Trocknen der Probe verändere sich die Zusammensetzung der Porenlösung permanent und dementsprechend ändere sich die zugehörige DRH, wobei das thermodynamische Gleichgewicht nicht erreicht werde. Letztendlich schloss Frank Seifert daraus, dass die KRL-Methode zur Feststellung der Belegreife nicht geeignet sei.
Wie erwartet folgte nach diesem Vortrag eine kon-troverse Diskussion, bei denen die bekannten unterschiedlichen Positionen zur Eignung der KRL-Methode bei der Ermittlung der Belegreife vor allem durch Oliver Erning (BEB-Arbeitskreis Sachverständige) bzw. Dr. Norbert Arnold (Technische Kommission Bauklebstoffe) vertreten wurden. Holger Wiehle (Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik) appellierte abschließend an die Teilnehmer, dass die beteiligten Gewerke hier doch zusammenfinden sollten. aus FussbodenTechnik 01/23 (Wirtschaft)
300 Teilnehmer sorgen für neuen Rekord
Das Sachverständigentreffen des Bundesverbands Estrich und Belag (BEB) fand in der 22. Auflage vom 11. bis 12. November 2022 im Mercure Hotel in Schweinfurt statt. Erstmalig knackte der Verband den Rekordwert von 300 Teilnehmern. Die elf Fachvorträge stammten aus den fünf Themenkomplexen Bodenbeläge, klinkereffiziente Zemente, Recht, Akustik und Feuchteaktivität.Schon traditionell führte Simon Thanner, Obmann des BEB-Arbeitskreises Sachverständige, als Moderator durch die zweitägige Veranstaltung im Schweinfurter Mercure-Hotel. Er richtete die Grüße des BEB-Vorsitzenden Michael Schlag aus, der kürzlich Vater geworden ist und deshalb nicht teilnehmen konnte. Simon Thanner berichtete in seiner Einführung, dass die sogenannte Rückvermeisterung des Estrichlegerhandwerks in absehbarer Zeit auf den Prüfstand kommen werde. Im Mittelpunkt stehe dabei zum einen die Gefahrgeneigtheit des Handwerks, zum anderen aber auch die Zahlen der Estrichlegermeister und der Estrichleger-Auszubildenden: "Die Zahl der Meister im Estrichlegerhandwerk steigt zwar, aber es gibt gar nicht mehr zusätzliche Plätze in den Meisterkursen. Bei den Lehrlingen flacht die Kurve der Estrichleger gerade ab", berichtete Thanner, der sich für Rückvermeisterung des Estrichlegerhandwerks im Jahr 2020 stark engagiert hatte und schließlich erfolgreich war. Thanner warb dafür, dass die Meisterpflicht im Estrichlegerhandwerk nicht automatisch für die Zukunft sicher sei, weil verschiedene politische Parteien das Thema unterschiedlich bewerten würden.
Was kaum ein Teilnehmer ahnte, sei als kleine Anekdote am Rande gestattet: Den viel beschriebenen Fachkräftemangel im Handwerk gab es ganz konkret auch am Tagungsort bei den Hotel-Mitarbeitern. So standen kurzerhand hinter dem Bar-Thresen ein leitender Hotel-Manager, sein Stellvertreter und ein Koch des Hotels, um die Sachverständigen wie gewohnt mit Getränken versorgen zu können. Sie alle, wie auch die Mitarbeiter des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, trugen zum Erfolg des 22. Internationalen Sachverständigentreffens bei, bei dem erstmals die Rekord-Marke von 300 Teilnehmern überschritten wurde.
FussbodenTechnik fasst die elf Fachvorträge zusammen:
Dr. David Reindl, Dr. Schutz
Oberflächenbeschichtung von Sichtestrichen und -spachtelmassen
Sichtspachtelböden erfreuen sich durch ihren industriellen Betonboden-Look zunehmender Beliebtheit. "Jeder dieser Böden ist ein Unikat", erklärte Dr. David Reindl, Leiter Entwicklung und Anwendungstechnik beim Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Dr. Schutz. Damit die mineralischen Böden auch hinsichtlich der Schmutzempfindlichkeit und des Reinigungsverhaltens dauerhaft attraktiv bleiben, empfiehlt sich eine schützende Versiegelung - also eine Beschichtung mit einem transparenten Lacksystem. Der Referent verglich die mineralischen Böden mit Holzbelägen, bei denen es sich ebenfalls um saugende Untergründe handelt. "Man muss die Saugfähigkeit sättigen oder blockieren, damit Flüssigkeiten nicht zu Farbveränderungen oder gar zu Abnutzungen führen", empfahl Dr. Reindl. Im Gegensatz zu Holz gibt es bei mineralischen Oberflächen keine Vorzugsrichtung des Auftrags aufgrund des Holzwuchses. Dafür kann allerdings die handwerkliche Applikation eine Uneinheitlichkeit des Auftrags verursachen: Denkbar sind optische Auffälligkeiten wie Rollenspuren und Überlappungsmarkierungen. Dr. Reindls Tipp: "Den mineralischen Untergrund für eine Versiegelung nicht zu fein schleifen." Eine Grundierung sollte grundsätzlich satt aufgetragen werden, um Rollenspuren zu verhindern und ein einheitliches optisches Bild zu erzeugen.
Eine Spachtelmasse sollte vom Spachtelmassenhersteller als ausgewiesen zur Erstellung von Sichtspachtelböden sein. Da der Spachtelboden die boden-
üblichen mechanischen und chemischen Belastungen aufnehmen muss, sind gemäß den Erfahrungen von Dr. Reindl im wesentlichen zementgebundene Spachtelmassen geeignet.
Eine aktuelle Liste der freigegebenen Spachtelmassen finden Interessierte auf der Webseite von Dr. Schutz. Insbesondere wichtig bei den Freigabeprüfungen ist die Haftung des Siegels am Untergrund, ohne die wichtige Funktionen der Oberfläche eingeschränkt werden.
Ralf Winter, Leiter Qualitätsmanagement bei Findeisen
Maßänderung bei Nadelvlies-Bodenbelägen
Ralf Winter, Leiter Qualitätsmanagement bei Findeisen, thematisierte Maßänderungen bei Bodenbelägen. Diese stellen grundsätzlich eine unvermeidbare, physikalische Gesetzmäßigkeit dar. Im Bezug auf Nadelvlies-Bodenbeläge kann die Höhe der Maßänderung durch die Konstruktion und die Wasseraufnahme der gewählten Polyamidfasern beeinflusst werden. Der Einsatz von "Standard-Polyamidfasern" - dazu zählen insbesondere Polyamid 6 und Polyamid 6.6 - bedingt höhere und nach den Regeln des Fachs zulässige Maßänderungen und macht eine feste Verklebung des Nadelvlies-
Bodenbelags mit geeigneten Klebstoffen erforderlich.
Durch den Einsatz anderer Polyamide ist eine Reduzierung der normativ zulässigen Maßänderung von max. 1,2 % (Bahnenware) auf max. 0,2 % möglich, sodass eine wiederaufnehmbare Verlegung (in Modulform, aber auch als Bahnenware ) möglich ist.
Bei Modulen nimmt das Polyamid deutlich weniger Wasser auf. Allerdings kann aus wirtschaftlichen Gründen auf die Verwendung von Standard-Polyamidfasern aktuell noch nicht verzichtet werden. Als alternative Polyamid-Beispiele nannte Winter PA 6.10, PA 6.12, PA 10.10, PA 11 und PA 12, die sich durch den unterschiedlichen Aufbau des eingesetzten Polymers auszeichnen. Standard-Polyamidfasern zeigten bei Vergleichstest in Form von Stuhlrollenprüfungen deutliche Vorteile z. B. gegenüber Polypropylen-Fasern, weil Polyamid deutlich geringere Aufhellungen zeigte, wie der Referent erläuterte.
Winter wies darauf hin, dass die die in der Norm DIN EN 1307 "Textile Beläge" genannten Parameter von mit einem Schrumpfungswert von 1,2 % (entspricht 12 mm pro m) und einem Ausdehnungswert von 0,5 % (5 mm pro m) nur für lose verlegte Bodenbeläge gilt, hingegen nicht für fest verklebte Bahnenware.
Ernst Weinzierl, ö.b.u.v. Sachverständiger
Problem LVT-Klickverbindungen
Der Sachverständige Ernst Weinzierl sensibilisierte für die Problematik von mangelhaften LVT-Klickverbindungen aus asiatischen Ländern, wobei er dabei explizit auf minderwertige Ware abstellte. Der großen Marktbedeutung der LVT-Klickbeläge stehe manchmal wenig Materialkenntnis bei Verkäufern und Verlegern gegenüber. Als Beispiel nannte Weinzierl die Berufsgruppe der Schreiner. Hinzu kämen Beratungsfehler, wenn extrem schwere Möbel (wie Öfen oder Küchenmöbel) auf die Klickbeläge gestellt werden, für deren Belastung sie gar nicht freigegeben wären. Den Verlegern empfahl Weinzierl dringend, die Verlegeanleitungen zu lesen, da manche Hersteller höhere Anforderungen stellen als die in Normen genannten. Er zitierte eine Reihe von Beispielen: So gibt es Hersteller, die fordern, den Belag 48 Stunden in den zu verlegenden Räumen oder in angrenzenden Räumen zu lagern. Deshalb reiche es nicht nicht aus, einen Lagerraum mit identischen klimatischen Bedingen zu wählen, weil der Verleger so den Herstellervorgaben nicht nachkomme (auch wenn er dies als fragwürdig empfand).
Ein anderes Beispiel sei die Begrenzung der Warmwassertemperatur einer Fußbodenheizung: Bodenbelagshersteller nennen durchaus 29 °C als erlaubte Grenze der Oberflächentemperatur. Der Verband MMFA hingegen benennt eine Kontakttemperatur von 27 °C - im Schadensfall können auch kleine Unterschiede den Ausschlag geben. Problematisch findet Weinzierl, dass sämtliche LVT-Beläge in der Regel die Anforderungen der Produktnorm DIN EN ISO 10582 bestehen. In der späteren Diskussion ergänzte der Sachverständige Torsten Grotjohann, dass Klickverbindungen durchaus bereits nach zwei Jahren Alterungserscheinungen aufweisen und brechen. Der Sachverständige Rainer Düßmann, der zahlreiche Klick-LVT-Schadensfälle begleitete, sieht die Temperaturschwankungen auf dem Transportweg als problematisch an: "In Südostasien kann sich ein Transport-Container durchaus auf 60 °C aufheizen und wird später im Winter bei uns bei 0 °C angeliefert." So könne es zu Vorschäden in den Belägen kommen. Nur mit Hilfe von labortechnischen Untersuchungen können man eventuellen Vorschäden sicher auf den Grund gehen.
Ernst Weinzierl appellierte abschließend an Baumärkte und den Großhandel, Klick-LVT aus zweifelhaften Quellen vor dem Inverkehrbringen zu überprüfen, um existentielle Schäden beim Verleger auszuschließen.
Prof. Dr. Christoph Müller, Geschäftsführer VDZ Technology
So gelingt die Dekarbonisierung von Zement und Beton in der Praxis
Wie kann es gelingen, den Kohlenstoffdioxidausstoß der deutschen Zementindustrie weiter zu senken? Und ist es möglich, in den nächsten 30 Jahren
klimaneutrale Herstellungsprozesse zu erreichen? Das waren Fragen, mit denen sich der Referent Prof. Dr. Christoph Müller, Geschäftsführer VDZ Technology, beschäftigte. Die Zementindustrie hat als starker Verursacher von CO bei der Herstellung ihrer Produkte ambitionierte Ziele, den Kohelnstoffdioxid- ausstoß zu minimieren. Prof. Dr. Müller stellte in diesem Zusammenhang die Publikation "Dekarbonisierung von Zement und Beton - Minderungspfade und Handlungsstrategien" vor. Diese zeigt auf, inwieweit der CO-Ausstoß der Branche in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits gesenkt wurde, wo die Stellschrauben für eine weitere Reduzierung zu finden sind und welche gesamtgesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen zu bewältigen wären, um eine Klimaneutralität des Baustoffs zu erreichen.
Die Verwendung klinkereffizienter Zemente ist ein wichtiger Baustein bei der Dekarbonisierung von Zement und Beton. Im Hochbau können über klinkereffiziente Zemente wie z. B. CEM II/C in der Herstellung des Betons kurzfristig etwa 20 % CO eingespart werden. Das Regelwerk für Beton muss noch konsequenter als bisher die Ziele Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz unterstützen. Hierzu zählt die differenzierte Verwendung klinkereffizienter Zemente, die auch im Estrich zum Einsatz kommen.
Egbert Müller, Leiter Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF)
IBF-Forschungsergebnisse zu klinkereffizienten Zementen
Egbert Müller, Leiter des Instituts für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF), stellte die Ergebnisse einer Untersuchung beim Einsatz von klinkereffizienten Zementen bei Estrichen vor. Diese wurde in Auftrag gegeben von den Zementherstellern Dyckerhoff, Schwenk Zement, Heidelberg Materials, Cemex und Holcim und mit Mitteln aus dem Forschungsetat des BEB gefördert. Grob gesagt untersuchte das IBF die Frischmörteleigenschaften, die Festigkeiten an Prismen, die Oberflächen- und Biegezugfestigkeit, das Schwind- und Austrocknungsverhalten sowie das Verformungsverhalten von Estrichen - mit und ohne klinkereffizienten Zementen. Folgende Aussagen konnten unter anderem getroffen werden: Die CM-Messung war bei allen geprüften mit klinkereffizienten Zementen hergestellten Zementestrichen uneingeschränkt möglich. Bei allen so hergestellten Zementestrichen kann der Belegreifgrenzwert 2 CM-% für unbeheizte Zementestriche angewendet werden. Bei einigen Zementestrichen sei allerdings mit einer längeren Austrocknungszeit zum Erreichen des Belegreifgrenzwerts 2 CM-% zu rechnen.
Georg Kuntner, Technischer Leiter e4 Bauchemie
Neue Zemente in Verbindung mit Estrichzusatzmitteln
"Neue klinkereffiziente Zemente können durchaus für Estriche eingesetzt werden", sagte Georg Kuntner, Technischer Leiter von e4 Bauchemie. Aus heutiger Sicht seien nicht alle der neuen Zemente zur Estrichherstellung sinnvoll. Hierzu sollten sich nach Ansicht des Sachverständigen Georg Kuntner auch die Zementhersteller Gedanken machen. Durch die höhere Anzahl an Zementen, vor allem CEM II/B- und CEM III-Zemente, wird die Variabilität deutlich größer. "Dies wird zur Folge haben, dass es sehr viel wichtiger wird, sich mit den einzelnen Komponenten des Estrichs auseinanderzusetzen", ist Kuntner überzeugt.
Da jedoch die Vielzahl an möglichen Einflüssen wie z. B. Sandqualität, Verarbeitung, Raumklima usw. einfließen, wird es für den Estrichhersteller immer anspruchsvoller, die vereinbarte Qualität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von geeigneten Zusatzmitteln könne in vielfacher Hinsicht positiv dazu beigetragen werden, jedoch könne kein Zusatzmittel "zaubern". Die größte Herausforderung für überregional verarbeitende Estrichfachbetriebe wird die Beschaffung bekannter Rohstoffe bzw. des "richtigen Zements" in Verbindung mit dem passenden Estrichsand und Zusatzmitteln werden, so der Referent abschließend.
Thomas Brendel, Chemotechnik Abstatt
Was muss der Estrichleger bei neuen Zementen beachten?
Der ö.b.u.v. Sachverständige für Estrich und Industrieböden, Thomas Brendel, Estrichlegermeister und Betontechnologe in Diensten von Chemotechnik Abstatt, beschäftigte sich mit der Frage, was der Estrichleger bei den neuen klinkereffizienten Zementen beachten muss.
Brendel erläuterte, dass sich die mit reduzierten Klinkergehalten und latent hydraulischen (= reaktiv) oder inerten (= nicht reaktiv) Bestandteilen hergestellten CEM II- und CEM III-Zemente in ihren Eigenschaften von bisherigen CEM I-Zementen unterscheiden. Die Auswahl an CEM II-Zementen ist groß: CEM II ist nicht CEM II. Je nachdem, welche Hauptbestandteile in den Zementzubereitungen enthalten sind und in welchen Anteilen, sind unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten.
Auch wenn Normprüfungen im Labor keine großen Unterschiede erkennen lassen, mahnt Brendel zur Vorsicht, Ergebnisse unter Laborbedingungen seien nicht auf die Baustelle übertragbar. Es ist zu erwarten, dass die bei Estrichen im Baustellenalltag häufig frühzeitige Austrocknung bei Estrichen aus klinkerreduzierten CEM II- und CEM III-Zementen zu vermehrten Problemen mit mangelnden Oberflächenfestigkeiten führen wird. Auch ist zu befürchten, dass die feinere Mahlung des Klinkers und die Verwendung von Hüttensand das Schwindverhalten der Estriche nachteilig beeinflusst.
Brendel wies darauf hin, dass die neuen Zemente sensibler auf kritische Baustellenbedingungen und Veränderungen der Rezeptur reagieren werden. Der Estrichhersteller muss deshalb für seinen Baustelllenestrich diejenigen Zemente und Zusatzmittel auswählen, die zum Erreichen der jeweiligen Anforderungen geeignet sind und er muss seiner in der Erstprüfung festgelegten Rezeptur treu bleiben.
Die Thematik ist nicht neu. Sie ernst zu nehmen wird mit der Umstellung auf CEM II- und CEM III-Zemente aber wichtiger denn je, wenn der Estrichleger keine unliebsamen Überraschungen erleben will.
Eine ausführliche Zusammenfassung des Referats finden Sie ab Seite 108.
Katharina Bleutge, Rechtsanwältin
Update JVEG - Neues zum Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
Die Justiziarin am Institut für Sachverständigenwesen in Köln, Katharina Bleutge, informierte die Sachverständigen über das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (abgekürzt JVEG). Dieses ist in Deutschland mit Wirkung vom 1. Juli 2004 an die Stelle des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZuSEG) und des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter getreten. Die Referentin informierte bei ihrem dritten Auftritt in Schweinfurt, wie die Sachverständigen ihre Honorarforderungen durchsetzen.
Die Sachverständigen werden nicht mehr nach Honorargruppen vergütet, sondern der Stundensatz richtet sich nach Feststundensätzen, die 39 Sachgebieten zugeordnet sind. Die Stundensätze liegen durchschnittlich zwischen 70 und 155 EUR. Die Zuordnung erfolgt nicht nach dem Bestellungstenor, sondern nach dem Inhalt des Beweisbeschlusses. Als Besonderheiten nannte Bleutge Gutachten, die mehrere Bereiche betreffen: Hier erfolgt die Berechnung nach dem höchsten Stundensatz. Für jede Stunde an Sonn- und Feiertagen oder zur Nachzeit gibt es einen Zuschlag in Höhe von 20 %.
Christian Hoppe, Ingenieurbüro Hoppe Akustik
Harter Boden - wohliges Raumgefühl dank Raumakustik
Christian Hoppe stellte die Grundlagen der Bau- und Raumakustik und deren Wirkung auf den Menschen vor. Entscheidend für eine angenehme Raumakustik ist dabei die Nachhallzeit, d. h. die Zeit die vergeht, bis der Schallpegel um 60 dB abgenommen hat. In einem üblichen Büroraum soll diese bei 0,5 bis 0,8 Sekunden liegen, in einem größeren Konferenzraum bei 0,8 bis 1,2 Sekunden und in Kirchen kann diese 4 bis 6 Sekunden erreichen. Ziel ist es, eine möglichst kurze Nachhallzeit zu erreichen, um die Lärmspirale aus schlechter Akustik, lauterer Unterhaltung und dadurch noch schlechterer Akustik zu vermeiden. Dazu stellte er zwei innovative Lösungen vor: Der Ringabsorber ist ein nur ca. 30 cm breites Band aus schallabsorbierendem Recycling-Material, das in den Deckenecken des Raums installiert wird. In den Deckenecken wird der Schall reflektiert und dann absorbiert. Somit kann mit relativ geringem konstruktivem Aufwand eine optisch ansprechende und schnell einzubauende Lösung für eine günstige Raumakustik verwirklicht werden.
Beim Streifenabsorber werden streifenförmige Absorber aus Recyclingglas in die Betondecke integriert. Die Schallreduktion erfolgt dabei zum einen durch das Absorbermaterial und darüber hinaus sehr wirksam auch über die Beton-Absorber-Kanten. Auch hier wird mit geringem Aufwand eine erhebliche Verbesserung der Raumakustik erreicht. Trotz harter Böden und Decken resultiert am Ende ein gutes Raumgefühl, was sich positiv auf die Aufenthaltsqualität und die Leistungsfähigkeit der Nutzer auswirkt.
Arnd Pferdehirt, Lanxess & Andreas Paul, Karl Bachl
Leichtausgleich - gewusst wie
Die Erderwärmung durch CO ist ein Thema, das uns alle betrifft. Zu dessen Reduktion kann der wärmedämmende Leichtausgleich mit expandiertem Polystyrol (EPS) seinen Beitrag leisten. Für Neumaterial wird dabei das Polystyrolgranulat mit Wasserdampf expandiert und in Form gebracht. Auch Recycling- material ist für die Verwendung im Leichtausgleich einsetzbar. Wichtig ist dabei eine effektive Eingangskontrolle des Recyclats, damit z. B. die Rückführung von als kritisch angesehenen Brandschutzmitteln in den Materialkreislauf verhindert wird. Seine volle Leistungsfähigkeit als Leichtausgleich aus EPS und Zement erreicht dieser erst durch Einsatz von speziellen Additiven, wie z. B. Antistatika zur Behandlung der Polystyrolkügelchen. Dadurch lassen sich die technischen Eigenschaften erheblich verbessern: Absetzen des Zements wird verhindert, die Druckfestigkeit wird erhöht und der W/Z-Wert erniedrigt, was zu kürzeren Trocknungszeiten führt. Der Restfeuchtegehalt des Leichtausgleichs kann über die CM-Messung ermittelt werden, wobei die zulässigen Restfeuchtewerte materialspezifisch vom Hersteller vorgegeben werden. Die Einsatzbedingungen für die Leichtausgleichsschichten werden über die einschlägigen Regelwerke DIN 18560-2, DIN 4108-10 sowie das BEB Hinweisblatt 4.6 vorgegeben.
Frank Seifert, Baustoffingenieur, seit November 2022 e4 Bauchemie
Was das KRL-Verfahren wirklich misst
Frank Seifert stellte vor, wie korrespondierende relative Luftfeuchten (KRL) über die Ermittlung der Sorptionsisothermen nach ISO/DIS 12571 mit den jeweiligen Feuchtegehalten zusammenhängen. Bei der KRL-Methode nach DIN EN 17668 wird die Feuchteaktivität als äquivalenter Wert des freibeweglichen Wassers im Prüfgut als KRL angesehen. Diese entspricht der relativen Luftfeuchte über der gesättigten Lösung des Porenwassers in der Probe. Diese relative Gleichgewichtsfeuchte wird auch als Deliqueszenzfeuchte (DRH) bezeichnet. "Der absolute Feuchtegehalt der Probe kann daraus nicht unmittelbar abgeleitet werden", so der Referent. Die über die KRL-Methode gemessene relative Luftfeuchte entspreche also der charakteristischen DRH der Porenflüssigkeit. Diese wiederum werde von den in der Porenflüssigkeit vorhandenen Salzen bestimmt. Hierzu wurde von Frank Seifert auch der Einfluss des Zusatzes unterschiedlicher Salze zu den Estrichmörtelrezepturen untersucht. Durch das Trocknen der Probe verändere sich die Zusammensetzung der Porenlösung permanent und dementsprechend ändere sich die zugehörige DRH, wobei das thermodynamische Gleichgewicht nicht erreicht werde. Letztendlich schloss Frank Seifert daraus, dass die KRL-Methode zur Feststellung der Belegreife nicht geeignet sei.
Wie erwartet folgte nach diesem Vortrag eine kon-troverse Diskussion, bei denen die bekannten unterschiedlichen Positionen zur Eignung der KRL-Methode bei der Ermittlung der Belegreife vor allem durch Oliver Erning (BEB-Arbeitskreis Sachverständige) bzw. Dr. Norbert Arnold (Technische Kommission Bauklebstoffe) vertreten wurden. Holger Wiehle (Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik) appellierte abschließend an die Teilnehmer, dass die beteiligten Gewerke hier doch zusammenfinden sollten. aus FussbodenTechnik 01/23 (Wirtschaft)
