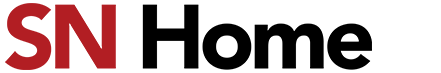
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
Schadensfall: Parkett-Schüsselung in schnell hochgezogenem Neubau
Anhand eines Schadensbildes, das Ablösung des Parketts vom Estrich, Schüsselung und Fugen mit teilweise über 5 mm aufwies, erläuterte Prof. Dr. Andreas Rapp von der Leibnitz Universität Hannover im Dialog mit Sachverständigenkollegen die Vorgehensweise einer gutachterlichen Analyse.
Hat der 2K-PUR-Klebstoff den verwendeten Dispersionsvorstrich auf dem Estrich erweichen können?
Das Gespräch mit dem Hersteller ergab, dass der Vorstrich in diesem Zusammenhang zwar nicht empfohlen werde, bei dünnem Auftrag aber keine Weichmacherschäden bekannt seien. Probeentnahmen bei losen sowie festen Parkettelementen zeigten kein einheitliches Bruchbild. Dem Dispersionsvoranstrich als Haftbrücke unterhalb des PU-Klebstoffsystems konnte weder ungenügendes adhäsives noch mangelhaftes kohäsives Verhalten nachgewiesen werden. Fazit: Zwar war die eingesetzte Grundierung theoretisch ungeeignet, aber in der Praxis nicht schadensursächlich.
Woher kommen unterschiedlich große Fugen in verschiedenen Räumen?
Um die Entwicklung der Holzfeuchte nachzuvollziehen, wird vom Parketthersteller das Messprotokoll der gelieferten Charge angefordert. Hinzu kommt das Holzfeuchtemessprotokoll des Parkettlegers. In Bezug auf das Schadensbild prüft der Gutachter die Fugengrößen in den betroffenen Räumen und bestimmt die Medianfuge - also nicht den Durchschnittswert, sondern jene Fugengröße, die genau in der Mitte steht, wenn man alle Messwerte der Größe nach sortiert. Bestimmung des Raumklimas vor Ort und Kontrolle der zurückliegenden Wetterdaten seit Parkettverlegung werden in die Meinungsbildung einbezogen.
Im beispielgebenden Fall zeigte sich die Lieferfeuchte als unverdächtig. Weil die Fugen in bestimmten Räumen größer ausfielen, musste es dort eine nachträgliche Feuchteaufnahme durch ein zurückliegendes Feuchteereignis gegeben haben.
Kann das Raumklima mit kritischen Feuchtewechseln das Parkett gequält haben?
Bei der Ortsbesichtigung ergab sich ein normales Raumklima von 21 °C und 53 % rLF. Die Holzfeuchte wurde mit 9,1 % gemessen, also unproblematisch gegenüber der erfragten Lieferfeuchte von 8,6 %. Auch der über einen längeren Zeitraum eingesetzte Datenlogger entlastete das Raumklima. Fazit: Das Raumklima hatte keinen Einfluss auf den Parkettschaden.
War möglicherweise eine Dampfsaunakabine im Bad undicht?
Die Vermutung, eine Dampfsauna im Bad hätte das Parkett im ganzen Haus aufgefeuchtet, ließ sich nicht bestätigen. Die räumliche Verteilung von Fugen und Schüsselung zeigte, dass die stärksten Parkettschäden weit entfernt vom Bad lagen. Außerdem konnte die Sauna im Obergeschoss nicht die Holzprobleme im Untergeschoss erklären. Fazit: Ein Wasserschaden ist nicht gänzlich ausgeschlossen, aber die Dampfsauna war es nicht.
Hat eine Fußbodenkühlung die Holzfeuchte zu stark ansteigen lassen?
Nutzt man im Sommer eine Fußbodenheizung zur Kühlung und senkt damit eine Raumtemperatur von 26 °C auf 22 °C, steigt die relative Luftfeuchte am Boden von 55 % auf 70 %. Das bedeutet eine Steigerung der Holzfeuchte von etwa 10 % auf 13 %. Es dauert jedoch Wochen oder Monate, abhängig von Holzart, Versiegelung und mehr. Fazit: Da nur einige Räume im Haus eine Kühlfunktion im Boden hatten, die größten Parkettschäden jedoch in anderen Räumen vorkamen, war die Fußbodenkühlung aus dem Schneider.
Estrichfeuchte und Beschleuniger: War der Estrich belegreif?
Verlegt worden war ein mit Zusatzmitteln beschleunigter Estrich des Typs 2, der laut Datenblatt einen erhöhten Belegreifwert von 3,5 CM-% ausweist. Messprotokolle gab es zunächst nicht, wurden dem gerichtlich bestellten Sachverständigen später nachgereicht, erwiesen sich aber bei einem Unterschriftenvergleich als offenbar gefälscht.
Die plastische Verformung des Parketts mit Fugen legt nahe, dass die Feuchte nach der Verlegung auf den Holzboden einwirkte. Die Konkavschüsselung besagt: Die Feuchte kam von unten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Estrich nicht belegreif. Prof. Rapp: "Man kann zwar auf erhöhter Estrichfeuchte verlegen, aber es geht nicht immer gut."
Stimmt die Behauptung des Estrichlegers, die Feuchte könne auch aus der 20 cm dicken Filigran-Betondecke kommen?
Von Baubeginn bis Parkettverlegung lagen weniger als vier Monate. Eine Dampfsperre zwischen Beton und Dämmung war nicht eingebaut worden. Die Systemplatte der Fußbodenheizung hatte zwar einen Diffusionswiderstand gegen Wasserdurchdringung aus dem Beton, jedoch könnten Befestigungslöcher der Platte sowie Nagelschuhe der Estrichleger eine Perforation bewirkt und in der Folge aufsteigende Feuchtigkeit ermöglicht haben. Fazit: Ein Schadensbeitrag aus der Betondecke wäre möglich.
Was geschah in den Bereichen, in denen das Parkett mit einer Klebefolie für Teppich abgedeckt war?
Beim Vergleich der Fugen in den verschiedenen Räumen stellte sich heraus, dass die Fugensummen dort am höchsten waren, wo als Unterlage für Teppich eine dichte Klebefolie verlegt worden war. Fazit: Nur dort, wo Folie lag, gab es Parkettschäden.
Ergebnisse der Untersuchungen
Bei diesem Schadensfall wanderte nachstoßende Feuchte aus dem Beton in einen beschleunigten Estrich, der den Feuchtegehalt vermutlich noch zusätzlich anreicherte. Solange der Estrich im Winter nicht abgedeckt wird, ist das kein Problem. Da das Haus aber in nur 100 Tagen erbaut und bezogen wurde, konnte die Feuchtigkeit nicht abziehen.
Behindert wurde die Trocknung durch den Diffusionswiderstand (sD-Wert) der verschiedenen Lagen des Bodenaufbaus, vor allem aber durch die erwähnte Klebefolie. Darunter steigt die Holzfeuchte in einer rechnerischen Annahme bei bestimmter Raumtemperatur von rund 7 % auf 18 %. Das ist in Kombination mit hoher Estrichfeuchte die ermittelte Hauptursache des Parkettschadens.
Henrik Stoldt aus Parkett Magazin 05/22 (Wirtschaft)
Ursachenanalyse eines Feuchteschadens
"Viele Parameter können für den Schaden an einem Holzboden ursächlich sein", stellte Prof. Dr. Andreas Rapp auf dem Sachverständigentag des BVPF in Köln fest - und begab sich auf Ursachenforschung.Anhand eines Schadensbildes, das Ablösung des Parketts vom Estrich, Schüsselung und Fugen mit teilweise über 5 mm aufwies, erläuterte Prof. Dr. Andreas Rapp von der Leibnitz Universität Hannover im Dialog mit Sachverständigenkollegen die Vorgehensweise einer gutachterlichen Analyse.
Hat der 2K-PUR-Klebstoff den verwendeten Dispersionsvorstrich auf dem Estrich erweichen können?
Das Gespräch mit dem Hersteller ergab, dass der Vorstrich in diesem Zusammenhang zwar nicht empfohlen werde, bei dünnem Auftrag aber keine Weichmacherschäden bekannt seien. Probeentnahmen bei losen sowie festen Parkettelementen zeigten kein einheitliches Bruchbild. Dem Dispersionsvoranstrich als Haftbrücke unterhalb des PU-Klebstoffsystems konnte weder ungenügendes adhäsives noch mangelhaftes kohäsives Verhalten nachgewiesen werden. Fazit: Zwar war die eingesetzte Grundierung theoretisch ungeeignet, aber in der Praxis nicht schadensursächlich.
Woher kommen unterschiedlich große Fugen in verschiedenen Räumen?
Um die Entwicklung der Holzfeuchte nachzuvollziehen, wird vom Parketthersteller das Messprotokoll der gelieferten Charge angefordert. Hinzu kommt das Holzfeuchtemessprotokoll des Parkettlegers. In Bezug auf das Schadensbild prüft der Gutachter die Fugengrößen in den betroffenen Räumen und bestimmt die Medianfuge - also nicht den Durchschnittswert, sondern jene Fugengröße, die genau in der Mitte steht, wenn man alle Messwerte der Größe nach sortiert. Bestimmung des Raumklimas vor Ort und Kontrolle der zurückliegenden Wetterdaten seit Parkettverlegung werden in die Meinungsbildung einbezogen.
Im beispielgebenden Fall zeigte sich die Lieferfeuchte als unverdächtig. Weil die Fugen in bestimmten Räumen größer ausfielen, musste es dort eine nachträgliche Feuchteaufnahme durch ein zurückliegendes Feuchteereignis gegeben haben.
Kann das Raumklima mit kritischen Feuchtewechseln das Parkett gequält haben?
Bei der Ortsbesichtigung ergab sich ein normales Raumklima von 21 °C und 53 % rLF. Die Holzfeuchte wurde mit 9,1 % gemessen, also unproblematisch gegenüber der erfragten Lieferfeuchte von 8,6 %. Auch der über einen längeren Zeitraum eingesetzte Datenlogger entlastete das Raumklima. Fazit: Das Raumklima hatte keinen Einfluss auf den Parkettschaden.
War möglicherweise eine Dampfsaunakabine im Bad undicht?
Die Vermutung, eine Dampfsauna im Bad hätte das Parkett im ganzen Haus aufgefeuchtet, ließ sich nicht bestätigen. Die räumliche Verteilung von Fugen und Schüsselung zeigte, dass die stärksten Parkettschäden weit entfernt vom Bad lagen. Außerdem konnte die Sauna im Obergeschoss nicht die Holzprobleme im Untergeschoss erklären. Fazit: Ein Wasserschaden ist nicht gänzlich ausgeschlossen, aber die Dampfsauna war es nicht.
Hat eine Fußbodenkühlung die Holzfeuchte zu stark ansteigen lassen?
Nutzt man im Sommer eine Fußbodenheizung zur Kühlung und senkt damit eine Raumtemperatur von 26 °C auf 22 °C, steigt die relative Luftfeuchte am Boden von 55 % auf 70 %. Das bedeutet eine Steigerung der Holzfeuchte von etwa 10 % auf 13 %. Es dauert jedoch Wochen oder Monate, abhängig von Holzart, Versiegelung und mehr. Fazit: Da nur einige Räume im Haus eine Kühlfunktion im Boden hatten, die größten Parkettschäden jedoch in anderen Räumen vorkamen, war die Fußbodenkühlung aus dem Schneider.
Estrichfeuchte und Beschleuniger: War der Estrich belegreif?
Verlegt worden war ein mit Zusatzmitteln beschleunigter Estrich des Typs 2, der laut Datenblatt einen erhöhten Belegreifwert von 3,5 CM-% ausweist. Messprotokolle gab es zunächst nicht, wurden dem gerichtlich bestellten Sachverständigen später nachgereicht, erwiesen sich aber bei einem Unterschriftenvergleich als offenbar gefälscht.
Die plastische Verformung des Parketts mit Fugen legt nahe, dass die Feuchte nach der Verlegung auf den Holzboden einwirkte. Die Konkavschüsselung besagt: Die Feuchte kam von unten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Estrich nicht belegreif. Prof. Rapp: "Man kann zwar auf erhöhter Estrichfeuchte verlegen, aber es geht nicht immer gut."
Stimmt die Behauptung des Estrichlegers, die Feuchte könne auch aus der 20 cm dicken Filigran-Betondecke kommen?
Von Baubeginn bis Parkettverlegung lagen weniger als vier Monate. Eine Dampfsperre zwischen Beton und Dämmung war nicht eingebaut worden. Die Systemplatte der Fußbodenheizung hatte zwar einen Diffusionswiderstand gegen Wasserdurchdringung aus dem Beton, jedoch könnten Befestigungslöcher der Platte sowie Nagelschuhe der Estrichleger eine Perforation bewirkt und in der Folge aufsteigende Feuchtigkeit ermöglicht haben. Fazit: Ein Schadensbeitrag aus der Betondecke wäre möglich.
Was geschah in den Bereichen, in denen das Parkett mit einer Klebefolie für Teppich abgedeckt war?
Beim Vergleich der Fugen in den verschiedenen Räumen stellte sich heraus, dass die Fugensummen dort am höchsten waren, wo als Unterlage für Teppich eine dichte Klebefolie verlegt worden war. Fazit: Nur dort, wo Folie lag, gab es Parkettschäden.
Ergebnisse der Untersuchungen
Bei diesem Schadensfall wanderte nachstoßende Feuchte aus dem Beton in einen beschleunigten Estrich, der den Feuchtegehalt vermutlich noch zusätzlich anreicherte. Solange der Estrich im Winter nicht abgedeckt wird, ist das kein Problem. Da das Haus aber in nur 100 Tagen erbaut und bezogen wurde, konnte die Feuchtigkeit nicht abziehen.
Behindert wurde die Trocknung durch den Diffusionswiderstand (sD-Wert) der verschiedenen Lagen des Bodenaufbaus, vor allem aber durch die erwähnte Klebefolie. Darunter steigt die Holzfeuchte in einer rechnerischen Annahme bei bestimmter Raumtemperatur von rund 7 % auf 18 %. Das ist in Kombination mit hoher Estrichfeuchte die ermittelte Hauptursache des Parkettschadens.
Henrik Stoldt aus Parkett Magazin 05/22 (Wirtschaft)
