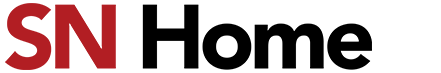
Das Nachrichtenportal von BTH-Heimtex · Haustex · Carpet Home · Eurodecor · FussbodenTechnik · Parkett Magazin
BVPF-Sachverständigentag: Wissenswertes für Parkettleger
Von einem Kunden, der in Frankreich 260 m2-Mahagoni-Parkett verlegen lassen wollte, berichtete Jochen Röck, Leiter Anwendungstechnik Pallmann, auf dem Sachverständigentag in Köln. Der beauftragte Handwerker bestellte im Handel Mahagoni-Parkett und bat gleichzeitig um eine Aufbauempfehlung. Geliefert wurde ein "Santos Mahagoni"-Parkett, dazu die gewünschte Verlegeempfehlung. Kopfschmerzen bekam der Handwerker erst bei der Oberflächenbehandlung mit einem Ölprodukt. Zweimal scheiterte der Auftrag. Schließlich erhielt der Beschichtungshersteller eine Materialprobe des Parketts und ließ sie im Thünen-Institut untersuchen. Das Ergebnis: Bei dem Holz handelte es sich nicht um klassisches Mahagoni, sondern um "Santos Mahogany", eine in Europa nicht gestattete Bezeichnung für Balsamo-Holz (Handelsname). Das Parkett kam aus China. Die Mittellage des Mehrschichtproduktes bestand aus Hevea/Rubberwood, der Gegenzug hatte eine unbekannte chinesische Bezeichnung. "Augen auf beim Holzeinkauf", lautet die Lektion. Das Problem für die doppelt gescheiterte Beschichtung waren die fremden Holzinhaltsstoffe.
Gerade mit Exotenholz sind unerwartete Phänomene nicht selten. Ipe Lapacho enthält Substanzen, die Benetzung mit wasserlöslichen Lacken schwierig machen, bei Wenge sind die Farbpigmente nicht UV-stabil und der singulär wachsende Padoukbaum enthält lichtreagierende Flavone - aber mit so unterschiedlichem Gehalt, dass ein Stab hell, ein anderer sehr dunkel wird. Und auch jenseits von UV-Strahlung können Verfärbungen auftreten. So färbt sich Esche bei wässriger Lackierung rosa, weil die Kohlenhydrate je nach Erntezeit entsprechend reagieren.
Unbekannte Schwarzfärbung
nach Neuversiegelung
"Wenn die Eiche blutet", lautete die Überschrift eines aktuellen Schadensbildes, das der Sachverständige Andreas Riedel aus Dresden zwei Jahre nach dem Schleifen, Kitten und Versiegeln eines 22 mm Eiche-Stabparketts zu Gesicht bekam. 2020 war in einer militärischen Einrichtung Altparkett aus den 1950er Jahren mit 2K-PU-Lack neu beschichtet worden. Nun trat in unterschiedlichen Bauabschnitten und Etagen an Fugen und Rissen schwarze Masse auf und quoll geradezu an die Oberfläche. Was konnte die Ursache sein? Hatte ein alkoholhaltiger Reiniger den alten Bitumenkleber angelöst? Und warum war das nicht schon früher geschehen? Vielleicht, weil der ursprüngliche, säurehärtende Lack die Eiche gut abgeschirmt hatte.
In Betrachtung eines mitgebrachten Parkettstabs aus dem Schadensfall analysierte Prof. Dr. Andreas Rapp von der Leibnitz Universität Hannover: "Die Schwarzfärbung riecht nicht nach Teer, sondern wirkt wie Holzkohle, ähnlich wie bei Thermoholz. Die Zellulose ist durch eine chemische Reaktion kaputt gegangen und geradezu verkohlt." Eine abschließende Erklärung könne nur eine chemische Untersuchung des Holzes bieten.
Hohlstellensanierung:
Injektionstechnik 3.0
"Seit drei Jahren hat sich der Stand der Technik entscheidend verändert", erklärte Parkettrestaurator Dieter Humm und meinte damit die Parkettsanierung von Decklamellenablösung und Hohlstellen. "Eine Eigenentwicklung des Kollegen Marko Domschke eröffnet neue Dimensionen. Maßen die Bohrlöcher erst 4 und dann 2,5 mm, so kann die Injektion unter das Holz heute mit bis zu 800 bar in nur 0,3 mm kleine Bohrungen erfolgen." Dies erlaube eine kostensparende, flächendeckende Sanierung von delaminiertem Mehrschichtparkett, wo bisher alles rausgerissen werden musste. Humm: "Der Zeitaufwand von 1 Min. für die Injektion gegenüber 120 Min. für den Dielentausch ist ein Quantensprung. Die kleinen Löcher werden am Ende verfüllt und sind unsichtbar."
Für diese Technik hat Domschke ein Gerät entwickelt. Gearbeitet wird mit erhitztem Knochenleim oder Silan-Klebstoff; ungern mit PU-Leim, der aufschäumen kann. Humm: "Solche Sanierungen sollte man weder im Sommer noch Winter machen, sondern wenn ausgeglichene Feuchtezeiten herrschen." Allerdings: Das über 10.000 EUR teure Gerät macht es nicht allein, es braucht einen Handwerker, der gut damit umgehen kann. Solch eine Spezialisten-Stunde ist nicht unter 85 EUR zu haben. Humm: "Es ist eine restauratorische Technik, die in den Alltag übersetzt wurde. Wir sollten das als Stand der Technik implementieren."
Widerruf eines Verbrauchervertrags
Man kann nicht oft genug auf die Stolperstellen des Verbraucherrechtes hinweisen. Auf dem Sachverständigentag warnte Dieter Humm Handwerkskollegen vor Fehlern bei der Auftragsannahme. Das aktuelle Beispiel hat zwar nichts mit Holz zu tun, ist aber typisch: Ein privater Bauherr verhandelt mit einem Installationsbetrieb in Vorgesprächen über den Einbau einer neuen Wärmepumpe. Später wird bei einem Treffen im Haus des Auftraggebers ein schriftlicher Vertrag geschlossen. Unmittelbar danach beginnen die Arbeiten. Vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist widerruft der Bauherr den Vertrag ohne nähere Gründe zu nennen und verlangt die von ihm geleistete Abschlagszahlung zurück. Der Handwerksbetrieb hält den Widerruf für unberechtigt, da er den Auftraggeber beim Vertragsabschluss umfassend aufgeklärt habe. Wer bekommt Recht?
Nachschlagen kann man im BGB bei den Paragraphen 13, 311, 312 und 355. Im Fall des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren.
Dumm gelaufen für den Handwerker. Der hat folgende Fehler gemacht: Erstens wurde keine Widerrufsbelehrung übergeben. Die muss zudem rechtlich fehlerfrei formuliert sein. Muster gibt es im Internet. Zweitens hätte er den Vertrag besser in seinen eigenen Geschäftsräumen abgeschlossen. Ein außerhalb unterschriebener Vertrag ohne ordnungsgemäße Belehrung erhöht sogar die Widerrufsfrist von 14 Tagen auf ein volles Jahr und 14 Tage. Das hat bereits das Amtsgericht Segeberg in einem Urteil vom 13.04.2015 festgestellt. Und auch im Fall der Wärmepumpe erklärte das Oberlandesgericht Celle am 12.01.2022 den Widerruf des Vertrages für wirksam und verneinte die Forderung des Auftragnehmers auf Ersatz seines mit dem Ausbau verbundenen Aufwands.
Was aber wäre gewesen, wenn der Auftrag per E-Mail geschlossen worden wäre? Dazu hat das Oberlandesgericht Schleswig unter dem Aktenzeichen 1 U 122/20 im Sinne eines Handwerksbetriebes entschieden: Bei Vertragsschluss per Mail nach persönlichem Termin gilt der Widerruf einer Auftraggeberin nicht. aus Parkett Magazin 05/22 (Wirtschaft)
Praxisfälle mit Aha-Effekt
Falsche Holzarten bei Neuverlegung, unbekannte Schwarzfärbung nach Neuversieglung, neue Methode zur Hohlstellensanierung und Stolperstellen des Verbraucherrechts - wissenswerte Besonderheiten und neuartige Techniken für die Parkettleger-Branche kamen auf dem Sachverständigentag in Köln in Kurzreferaten zur Sprache.Von einem Kunden, der in Frankreich 260 m2-Mahagoni-Parkett verlegen lassen wollte, berichtete Jochen Röck, Leiter Anwendungstechnik Pallmann, auf dem Sachverständigentag in Köln. Der beauftragte Handwerker bestellte im Handel Mahagoni-Parkett und bat gleichzeitig um eine Aufbauempfehlung. Geliefert wurde ein "Santos Mahagoni"-Parkett, dazu die gewünschte Verlegeempfehlung. Kopfschmerzen bekam der Handwerker erst bei der Oberflächenbehandlung mit einem Ölprodukt. Zweimal scheiterte der Auftrag. Schließlich erhielt der Beschichtungshersteller eine Materialprobe des Parketts und ließ sie im Thünen-Institut untersuchen. Das Ergebnis: Bei dem Holz handelte es sich nicht um klassisches Mahagoni, sondern um "Santos Mahogany", eine in Europa nicht gestattete Bezeichnung für Balsamo-Holz (Handelsname). Das Parkett kam aus China. Die Mittellage des Mehrschichtproduktes bestand aus Hevea/Rubberwood, der Gegenzug hatte eine unbekannte chinesische Bezeichnung. "Augen auf beim Holzeinkauf", lautet die Lektion. Das Problem für die doppelt gescheiterte Beschichtung waren die fremden Holzinhaltsstoffe.
Gerade mit Exotenholz sind unerwartete Phänomene nicht selten. Ipe Lapacho enthält Substanzen, die Benetzung mit wasserlöslichen Lacken schwierig machen, bei Wenge sind die Farbpigmente nicht UV-stabil und der singulär wachsende Padoukbaum enthält lichtreagierende Flavone - aber mit so unterschiedlichem Gehalt, dass ein Stab hell, ein anderer sehr dunkel wird. Und auch jenseits von UV-Strahlung können Verfärbungen auftreten. So färbt sich Esche bei wässriger Lackierung rosa, weil die Kohlenhydrate je nach Erntezeit entsprechend reagieren.
Unbekannte Schwarzfärbung
nach Neuversiegelung
"Wenn die Eiche blutet", lautete die Überschrift eines aktuellen Schadensbildes, das der Sachverständige Andreas Riedel aus Dresden zwei Jahre nach dem Schleifen, Kitten und Versiegeln eines 22 mm Eiche-Stabparketts zu Gesicht bekam. 2020 war in einer militärischen Einrichtung Altparkett aus den 1950er Jahren mit 2K-PU-Lack neu beschichtet worden. Nun trat in unterschiedlichen Bauabschnitten und Etagen an Fugen und Rissen schwarze Masse auf und quoll geradezu an die Oberfläche. Was konnte die Ursache sein? Hatte ein alkoholhaltiger Reiniger den alten Bitumenkleber angelöst? Und warum war das nicht schon früher geschehen? Vielleicht, weil der ursprüngliche, säurehärtende Lack die Eiche gut abgeschirmt hatte.
In Betrachtung eines mitgebrachten Parkettstabs aus dem Schadensfall analysierte Prof. Dr. Andreas Rapp von der Leibnitz Universität Hannover: "Die Schwarzfärbung riecht nicht nach Teer, sondern wirkt wie Holzkohle, ähnlich wie bei Thermoholz. Die Zellulose ist durch eine chemische Reaktion kaputt gegangen und geradezu verkohlt." Eine abschließende Erklärung könne nur eine chemische Untersuchung des Holzes bieten.
Hohlstellensanierung:
Injektionstechnik 3.0
"Seit drei Jahren hat sich der Stand der Technik entscheidend verändert", erklärte Parkettrestaurator Dieter Humm und meinte damit die Parkettsanierung von Decklamellenablösung und Hohlstellen. "Eine Eigenentwicklung des Kollegen Marko Domschke eröffnet neue Dimensionen. Maßen die Bohrlöcher erst 4 und dann 2,5 mm, so kann die Injektion unter das Holz heute mit bis zu 800 bar in nur 0,3 mm kleine Bohrungen erfolgen." Dies erlaube eine kostensparende, flächendeckende Sanierung von delaminiertem Mehrschichtparkett, wo bisher alles rausgerissen werden musste. Humm: "Der Zeitaufwand von 1 Min. für die Injektion gegenüber 120 Min. für den Dielentausch ist ein Quantensprung. Die kleinen Löcher werden am Ende verfüllt und sind unsichtbar."
Für diese Technik hat Domschke ein Gerät entwickelt. Gearbeitet wird mit erhitztem Knochenleim oder Silan-Klebstoff; ungern mit PU-Leim, der aufschäumen kann. Humm: "Solche Sanierungen sollte man weder im Sommer noch Winter machen, sondern wenn ausgeglichene Feuchtezeiten herrschen." Allerdings: Das über 10.000 EUR teure Gerät macht es nicht allein, es braucht einen Handwerker, der gut damit umgehen kann. Solch eine Spezialisten-Stunde ist nicht unter 85 EUR zu haben. Humm: "Es ist eine restauratorische Technik, die in den Alltag übersetzt wurde. Wir sollten das als Stand der Technik implementieren."
Widerruf eines Verbrauchervertrags
Man kann nicht oft genug auf die Stolperstellen des Verbraucherrechtes hinweisen. Auf dem Sachverständigentag warnte Dieter Humm Handwerkskollegen vor Fehlern bei der Auftragsannahme. Das aktuelle Beispiel hat zwar nichts mit Holz zu tun, ist aber typisch: Ein privater Bauherr verhandelt mit einem Installationsbetrieb in Vorgesprächen über den Einbau einer neuen Wärmepumpe. Später wird bei einem Treffen im Haus des Auftraggebers ein schriftlicher Vertrag geschlossen. Unmittelbar danach beginnen die Arbeiten. Vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist widerruft der Bauherr den Vertrag ohne nähere Gründe zu nennen und verlangt die von ihm geleistete Abschlagszahlung zurück. Der Handwerksbetrieb hält den Widerruf für unberechtigt, da er den Auftraggeber beim Vertragsabschluss umfassend aufgeklärt habe. Wer bekommt Recht?
Nachschlagen kann man im BGB bei den Paragraphen 13, 311, 312 und 355. Im Fall des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren.
Dumm gelaufen für den Handwerker. Der hat folgende Fehler gemacht: Erstens wurde keine Widerrufsbelehrung übergeben. Die muss zudem rechtlich fehlerfrei formuliert sein. Muster gibt es im Internet. Zweitens hätte er den Vertrag besser in seinen eigenen Geschäftsräumen abgeschlossen. Ein außerhalb unterschriebener Vertrag ohne ordnungsgemäße Belehrung erhöht sogar die Widerrufsfrist von 14 Tagen auf ein volles Jahr und 14 Tage. Das hat bereits das Amtsgericht Segeberg in einem Urteil vom 13.04.2015 festgestellt. Und auch im Fall der Wärmepumpe erklärte das Oberlandesgericht Celle am 12.01.2022 den Widerruf des Vertrages für wirksam und verneinte die Forderung des Auftragnehmers auf Ersatz seines mit dem Ausbau verbundenen Aufwands.
Was aber wäre gewesen, wenn der Auftrag per E-Mail geschlossen worden wäre? Dazu hat das Oberlandesgericht Schleswig unter dem Aktenzeichen 1 U 122/20 im Sinne eines Handwerksbetriebes entschieden: Bei Vertragsschluss per Mail nach persönlichem Termin gilt der Widerruf einer Auftraggeberin nicht. aus Parkett Magazin 05/22 (Wirtschaft)
